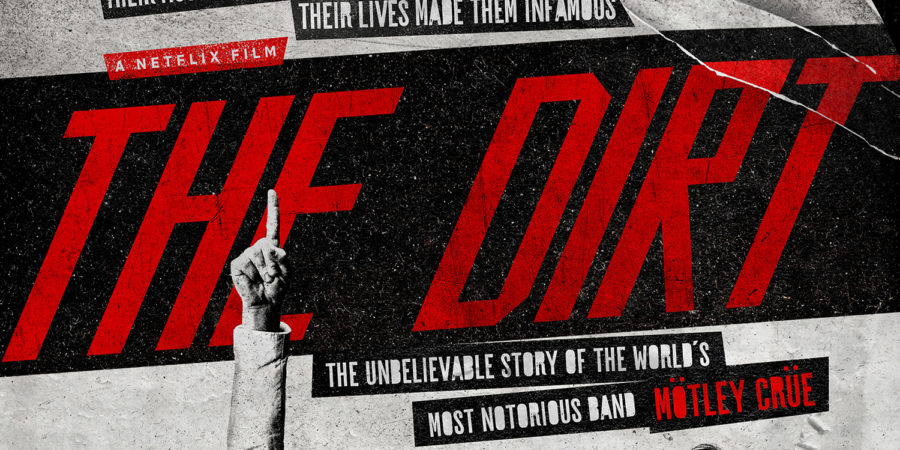The Dirt
Filmkritik zum Mötley-Crüe-Biopic
Special
2019 ist ein gutes Filmjahr für Metalheads. Nach der finnischen Komödie „Heavy Trip“ und dem umstrittenen Black-Metal-Streifen „Lords Of Chaos“ erscheint mit „The Dirt“ nun schon der dritte schwermetallische Streifen des Jahres. Eine Dekade lang war die Verfilmung der gleichnamigen Biografie von MÖTLEY CRÜE im Gespräch gewesen. Manch einer hat wohl nicht mehr an eine Umsetzung geglaubt. Doch jetzt ist sie da und erscheint exklusiv bei Netflix, dem wohl populärsten aller Streamingdienste.
MÖTLEY CRÜE gehen keine Kompromisse ein
Der Grund dafür liegt auf der Hand: „The Dirt“ stellt die Geschichte der Band mit all ihren Exzessen, Drogenproblemen und persönlichen Rückschlägen schonungslos dar. Verschiedene Studios, die an dem Stoff interessiert waren, hatten der Band vorgehalten, welche Passagen fürs Kino ungeeignet seien. Netflix wiederum ließ MÖTLEY CRÜE bei der Verfilmung freie Hand.
Alles andere wäre Verrat sowohl am Buch als auch der Band selbst gewesen. Der völlige Wahnsinn von Nikki Sixx, Vince Neil, Tommy Lee und Mick Mars macht schließlich einen Großteil der Faszination aus, durch die MÖTLEY CRÜE bis heute populär sind. Als Regisseur betrauten sie Jeff Tremaine mit dem Projekt. Der machte sich in der Vergangenheit vor allem durch die „Jackass“-Filme einen Namen. Da die ebenso durchgeknallt sind wie die Geschichte der CRÜE, passt diese Kombination wie die Faust aufs Auge.
„The Dirt“ entwickelt einen zwingenden Sog
Schon die erste Szene des Films, in der die Band eine Party in der WG ihrer Anfangstage schmeißt, macht klar, wohin die Reise geht. Kokain, Alkohol, Toilettensex, ejakulierende Frauen – die ersten Minuten von „The Dirt“ verdienen sich schon die 18er-Freigabe. Im Folgenden hält sich der Film ebenso wenig zurück. Insbesondere Nikki Sixx‘ Heroinabhängigkeit fängt Tremaine in bedrückenden Bildern ein. Und doch kommt man um ein Lachen nicht herum, wenn die Sanitäter Sixx in bester „Pulp Fiction“-Manier via Adrenalinspritze ins Leben zurückholen.
Dieser Spagat zwischen irrsinnigem Witz und den düsteren Abstürzen der Bandmitglieder hat „The Dirt“ bereits in Buchform ausgezeichnet. Der Film atmet dieselbe Atmosphäre. Zudem bedient sich Tremaine der gleichen Erzählweise wie die Vorlage. Diese filmisch umzusetzen, ist gar nicht so einfach. Schließlich bekommen im Buch alle Bandmitglieder sowie einige Wegbegleiter eigene Kapitel, in denen sie ihre Sicht der Dinge darlegen. Das führt oft zu unterschiedlicher Bewertung einiger Vorkommnisse, manchmal sogar zu waschechten Widersprüchen.
Wer braucht schon Fakten?
Um das einzufangen lässt Tremaine seine Hauptcharakter das Geschehen nicht nur aus dem Off kommentieren. Häufig durchbrechen sie die vierte Wand und sprechen direkt zum Zuschauer. Das führt zu kuriosen Situationen. So erklärt Mick Mars, dass MÖTLEY CRÜE ihren Manager Doc McGhee gar nicht auf der Party angetroffen haben, auf der er im Film zu sehen ist. Dass McGhees Partner Doug Thaler überhaupt nicht auftaucht, kommentiert Mars‘ Filmversion ebenso lakonisch: „Es ist irgendwie scheiße, dass er aus Zeitgründen aus dem Film gestrichen wurde.“
Neben einer Menge cooler Gags erfüllen diese Metamomente einen weiteren wichtigen Zweck. Durch sie macht Tremaine deutlich, dass „The Dirt“ keine Faktenwiedergabe ist. Vor allem gegen Ende entschuldigt das einige Passagen, in denen der Regisseur mit enorm hohen Tempo durch die Geschichte brettert. Die Phase mit Sänger John Corabi wird in einer Minute abgehandelt. Corabi selbst kommt nicht einmal zu Wort.
Verschenkte Möglichkeiten
Das ist schade, denn diese schwierige Zeit der Bandgeschichte hätte filmisch einiges hergegeben. Da der Zuschauer allerdings wenige Minuten zuvor erst Vince Neil dabei zugesehen hat, wie er mit dem Krebstod seiner Tochter kämpft, während Nikki Sixx sich aus der Drogenhölle zu befreien versucht, wären weitere Tiefschläge dieser Art dramaturgisch wohl schwierig geworden. Kurz bevor man als Zuschauer jegliche Hoffnung auf Besserung verliert, präsentiert der Film die erste Reunion der Originalmitglieder 1997 als Happy End, obwohl sie in der Realität alles andere als glücklich verlaufen ist. Hier schmeißt der Film diese erste Reunion mit der von 2005 zusammen, um die Laufzeit nicht völlig zu sprengen.
Die Zeit dazwischen hätte sonst locker als Stoff für einen weiteren Film herhalten können. Sei es die vollkommen irrsinnige Ehe von Tommy Lee mit Pamela Anderson, die kreative Bruchlandung mit dem „Generation Swine“-Album oder Lees anschließender Ausstieg – es hätte noch einiges zu erzählen gegeben. Trotz ein paar solcher Holprigkeiten gegen Ende bleibt „The Dirt“ seiner Vorlage weitestgehend treu. Bei einer Laufzeit von knapp zwei Stunden muss man eben Abstriche machen. Viel entscheidender ist ohnehin die Darstellung der Bandmitglieder.
Unbegründete Zweifel
Wer dank dem schlampigen Trailer skeptisch war, der kann bei „The Dirt“ nach wenigen Minuten aufatmen. Einfach alle Bandmitglieder sind so perfekt getroffen, wie man es sich von einem Film nur wünschen kann. Douglas Booth bringt sowohl den Enthusiasmus von Nikki Sixx als auch seine emotionalen Traumata perfekt rüber. Wenn er in einer Szene nach Jahren der Funkstille seine Mutter wiedertrifft und vor Wut in Tränen ausbricht, leidet der Zuschauer mit. Genauso kann man sich mit Sixx über alle Moment freuen, die ihn der seelischen Heilung näher bringen.
Entscheidend dafür ist seine Freundschaft zu Schlagzeuger Tommy Lee. Und gottverdammt geht Colson Baker alias Machine Gun Kelly in dieser Rolle auf. Der Rapper spielt Lee nicht, er ist für 107 Minuten der Schlagzeuger von MÖTLEY CRÜE. Vom Look über die Bewegungen, bis hin zu den stets überschwänglichen Gefühlen des Trommlers, füllt Baker seine Rolle mit so viel Leben, dass man hier keinen Schauspieler mehr vor sich sieht, sondern nur noch die Figur. Besonders in Erinnerung bleibt eine Szene, in der ein typischer Tourtag aus seiner Perspektive gezeigt wird – demoliertes Hotelzimmer inklusive.
Der filmische Zwilling
Ganz ähnlich verhält es sich mit Iwan Rheon (Ramsay Bolton in „Game Of Thrones„), der Gitarrist Mick Mars verkörpert. Insbesondere mit Sonnenbrille sieht er seinem realen Gegenstück zum verwechseln ähnlich. Dass er im Gegensatz zu seinen Kollegen minimal besonnener ist und stets cool bleibt, macht ihn zum Ruhepol des Films. Rheon sorgt mit seiner Performance und den regelmäßigen Metakommentaren dafür, dass „The Dirt“ trotz seiner überzeichneten Rock’n’Roll-Exzesse auf dem Teppich bleibt.
Daniel Webber wiederum sieht Vince Neil leider kaum ähnlich. Doch transportiert er das Charisma des Sängers ziemlich gut auf die Leinwand. Am meisten glänzt er in den emotionalen Momenten. Wenn er am Krankenbett seiner Tochter sitzt und um ihr Leben bangt, fühlt man als Zuschauer ohne Umschweife mit. Gleiches gilt für den fatalen Autounfall 1984 mit dem durch Neil verschuldeten Tod von HANOI ROCKS-Schlagzeuger Razzle.
Die nötige Authentizität
Als weiteren großen Pluspunkt haben die Schauspieler einige ausgewählte Songs wie „Live Wire“ oder „Too Young Too Fall In Love“ gemeinsam eingeprobt. Das sorgt in den Konzertszenen, Studiomomenten und Proben der Band für die nötige Authentizität. Zudem zeigt sich daran die Liebe zum Detail, mit der das Team hinter „The Dirt“ an dem Film gearbeitet hat. Beim Schauen wird man das Gefühl nicht los, ein echtes Herzensprojekt aller Beteiligten zu sehen.
Wer auch nur im entferntesten an MÖTLEY CRÜE, ihrer Geschichte und Rock-Biopics generell interessiert ist, sollte sich „The Dirt“ nicht entgehen lassen. Wenn man es mit den Fakten nicht allzu genau nimmt, hat man von der ersten bis zur letzten Sekunde eine Menge Spaß. Zukünftige Biopics dieser Art werden es verdammt schwer haben.