
Running Wild
Zwei Stühle, zwei Meinungen
Special
Dass RUNNING WILD-Alben nicht erst seit gestern polarisieren, ist schon länger klar. Dass die Gemeinde aber so gespalten wird, wie auf dem neuen Album „Blood On Blood“ konnte man nach den starken Vorgängern nun wirklich nicht erwarten. Grund genug, warum wir uns zu einer „Plus-/Minus-Kritik“ durchgerungen haben. Oliver Di Iorio und meine Wenigkeit haben das Album auf Herz und Nieren geprüft und sind zu zwei unterschiedlichen Ergebnissen gekommen.
Der Kapitän und seine Piratencrew sind wieder da. Ganze fünf Jahre nach dem letzten, starken Studioalbum „Rapid Foray“ veröffentlichen RUNNING WILD unter Führung ihres Masterminds Rolf Kasparek mit „Blood On Blood“ ihr siebzehntes Album. „Rapid Foray“ atmete den Spirit der alten RUNNING WILD-Klassiker und auch dessen Vorgänger „Resilient“ hatte starke Momente und ging als gutklassiges Album über die Zielgeraden. Wie steht es aber um „Blood On Blood“? Kann der Kapitän nach fünf Jahren an diese starke, neue Bandphase anknüpfen?
Segel gesetzt…und dann?
Klares Fazit vorne weg, nein. Kann er nicht. Das fängt beim wieder einmal sehr einfach gehaltenen Cover an, zieht sich über den Sound der Platte bis zum Songwriting hin. Es wirkt so als wäre der positive Effekt, der „Rapid Foray“ noch inne wohnte, völlig verpufft. So startet der Titelgebende Opener „Blood On Blood“ zwar mit typischem Riffing in das Album, aber genau das hat man schon wesentlich besser von den Hanseaten gehört. Gleiches gilt auch für das im Anschluss dargebotene „Wings Of Fire“, das zwar auch auf vertrautes Riffing und einen für RUNNING WILD typischen Midtempo-Stampfer setzt. Aber auch hier fehlt eindeutig die Durchschlagskraft gegenüber den beiden Vorgängern. Ein Vergleich mit den Klassikern zu ziehen wäre „Blood On Blood“ gegenüber sehr unfair, weshalb sich hier auf die letzten drei Alben bezogen wird. Und dennoch kommt das siebzehnte Album von Rolf und seinen Mannen nicht ansatzweise an seinen direkten Vorgänger heran. Dafür fehlt der Scheibe einfach der Esprit und der Wille noch einmal ein Zeichen zu setzten.
Uninspiriertes Songwriting und ein unkreativer Drummer
So richtig, richtig schlecht ist das Album nicht, aber es fehlt halt an allen Ecken und Enden an zugkräftigem Material. Klar, Stücke wie die beiden vorab ausgekoppelten „Diamons And Pearls“ und „Crossing The Blades“ gehen gut ins Ohr. Vor allem zweitgenannte Nummer kann dabei noch damit punkten, die beste Nummer der Platte zu sein. Beide klingen auf der anderen Seite aber sehr konstruiert (vor allem im Refrain-Bereich). Wo die erste Seite des Albums noch so halbwegs schadensfrei daher kommt, verliert der zweite Teil des Albums definitiv noch mehr an Fahrt. Mit „One Night One Day“ und „Wild Wild Nights“ stehen gegen Ende der Platte dann zwei absolute Tiefpunkte im rolfschen Schaffen. Erstgenannte Nummer ist eine grausige Ballade (und Rolf wollte doch nie eine schreiben), während „Wild Wild Nights“ das ebenfalls mit einem schönen Ohrwurmcharakter ausgezeichnet ist und auch live gut funktionieren dürfte, insgesamt aber nicht wirklich Substanz hat. Das, die Platte abschließende „The Iron Times 1618-1648)“ schippert dann belanglos am Hörer vorbei und man hat das Gefühl hier wurde der Song etwas künstlich aufgepumpt wurde. Wenn man die Nummer mit einer Göttergabe wie „Bloody Island“ vergleicht, zieht der Abschluss von „Blood On Blood“ klar den Kürzeren.
Bloß nicht mit den Klassikern vergleichen
Es wäre unfair „Blood On Blood“ mit den Klassikern von RUNNING WILD zu vergleichen, weshalb sich während des Reviews nur auf die letzten Alben der Hamburger bezogen wurde. Aber verglichen mit eben „Resilient“ und „Rapid Foray“ kann „Blood On Blood“ nur wenig überzeigen. Das liegt zum einen an den wieder einmal zu statisch eingespielten Drums von Angelo Sasso (der Junge könnte sich wirklich mal ein paar neue Breaks und Fills drauf schaffen), und zum anderen an der mangelnden Qualität im Songwriting-Bereich. So bleiben für „Blood On Blood“ nur magere vier Pünktchen (ja, es waren im Soundcheck mehr, aber ich habe die Scheibe danach noch ein paar Mal gehört). Wie gesagt, wenn man die beiden direkten Vorgänger dagegen hält, bleibt da nicht viel Positives übrig. Colin Büttner (4/10)
Immer wenn RUNNING WILD ein neues Album veröffentlichen, trennt sich das Heavy-Metal-Lager in zwei Gruppen. Die einen recken die Faust empor und rücken die Augenklappe zurecht, während die anderen schulterzuckend damit weitermachen, wo sie gerade aufgehört hatten. Ein Dazwischen gibt es normaler Weise nicht.
Holzbein ick hör dir trapsen
Mit “Blood On Blood” könnte sich das oben geschilderte Schwarmverhalten jedoch ändern. Das Album macht es einem nicht leicht, es zu mögen. Die manchmal – nun ja – geilen Riffs und die umgehend mitsingbaren Refrains machen es einem auch nicht leicht, das Album zu hassen.
Speziell die beiden Auftakt-Songs besitzen genug Kraft, Geschwindigkeit und Finesse, um eine Großtat einzuleiten. Dagegen wirken “Diamonds And Pearls” oder “Wild And Free” (alleine der Titel, also bitte) wie Bremsklötze unter der sonst stets so souveränen RUNNING-WILD-Bereifung. Nicht, dass die Stücke lahm wären, sie sind einfach langweilig.
RUNNING WILD: Gekreuzte Klingen, Wilde Nächte
Dann möchte man wieder dankend auf die Knie sinken, wenn Rock´N´Rolf bei “Crossing The Blades” zu einem großartig käsigen Chorus intoniert. Besonders das Signature-Riffing mit Twin-Guitars und einer Double Bass, die Angelo Sasso Tränen vor Rührung in die Augen treiben würde machen richtig Spaß. Im Mittelteil bricht der Song in ein großartiges Solo aus und schlagartig erinnert man sich wieder, warum man seine RUNNING-WILD-Sammlung nicht längst im Spint von Davy Jones verräumt hat.
Von diesen Momenten gibt es auf “Blood On Blood” leider nicht sehr viele, stattdessen kommt der Balladen-Versuch “One Night One Day” aus den Boxen gekrochen. Kasparek hätte seiner Linie treu bleiben und auf derart Schmonzetten-Arrangement weiterhin verzichten sollen, da rettet den Song auch das über und über meldodiöse Zwischenspiel nicht, vom Mitklatsch-Part ganz zu schweigen.
“Blood On Blood” ist ambivalent, frisch und verstaubt zugleich
Letztlich schaffen RUNNING WILD mit diesen zehn Liedern etwas, womit man nur bedingt rechnen konnte. Teilweise klingen all die heroischen Hymnen so schön verstaubt, dass man sich sofort heimelig fühlt und jeden Refrain, der ja praktischer Weise gleichzeitig der Songtitel ist, mitsingen möchte. Andererseits ist die Produktion teilweise zu clean und manchmal auch mit Large-Room-Effekten und Delays jeglicher Couleur einfach aus der Zeit gefallen. Während man sich fragt, was man von diesem 80s-Worshipping halten soll, geht der Abschluss-Track “The Iron Times 1618-168” in einem wahren Epos auf, das wirklich bis zum Anschlag mit RW-Trademarks vollgestopft ist.
Sofort verspürt man wieder diesen fast kindlichen Drang, ein Bein auf´s Rumfass zu stellen und lauthals “Ready For Boarding” zu skandieren. Aaarrrggggh! Oliver Di Iorio (6/10)



Mehr zu Running Wild
| Band | |
|---|---|
| Stile | Heavy Metal, Power Metal, True Metal |
Interessante Alben finden
Auf der Suche nach neuer Mucke? Durchsuche unser Review-Archiv mit aktuell 37565 Reviews und lass Dich inspirieren!















 Colin Büttner
Colin Büttner 









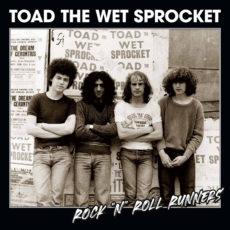


















Kommentare
Sag Deine Meinung!