Primordial
Das meint die Redaktion zu "Where Greater Men Have Fallen"
Special
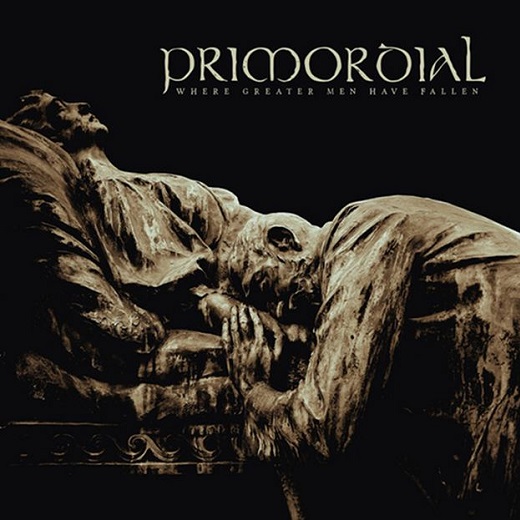
Wird es ein Meisterwerk? Oder geht’s sogar noch drüber? Na, drunter ist jedenfalls beinahe unvorstellbar. Solche oder so ähnliche Gedanken werden bei nicht wenigen Freunden der Iren PRIMORDIAL kreisen, wenn ein neues Album ansteht. Gerade dann macht es Sinn, wenn mehrere Redaktionsköpfe rauchen und ihren subjektiven Senf zu „Where Greater Men Have Fallen“ dazugeben. So viel sei schon mal verraten: Die Tendenz geht in eine andere Richtung.
PRIMORDIAL und ich, das ist keine Liebesgeschichte. Klar, ich erkenne die Genialität so mancher Komposition der Iren an – vor allem seit 2002 können sich die Herren aus Dublin ja einige Großtaten auf die Haben-Seite schreiben. Aber erreicht haben sie mich damit trotzdem nie richtig – ohne dass ich sagen könnte, woran das liegt. Ihre Kompositionen verfügen über das richtige Mischverhältnis aus Komplexität, Eingängigkeit und Emotion, aber vor allem mit letzterer treffen PRIMORDIAL zu selten meinen Nerv. Die Musik ist für mich emotional, aber sie haut mich nicht um.
Ihr neues, achtes Album „Where Greater Men Have Fallen“ stellt leider keine Ausnahme dar. Abgesehen vom eröffnenden Titeltrack haut mich nichts auf dem Album aus den Socken, auch wenn die komplette Scheibe ordentlich gemacht ist. Hier und dort lassen mich PRIMORDIAL im Verlauf nochmal aufhorchen – „Come The Flood“, das disharmonisch-schiefe „The Alchemist’s Head“ oder der Abschluss in Form von „Wield Lightning To Split The Sun“, aber das ist zu wenig, um mich zu fesseln. Zu allem Überfluss fehlt ein Übersong wie zum Beispiel „The Coffin Ships“, den eigentlich alle anderen Alben hatten. Und darüber hinaus bleibt der Eindruck nicht aus, „Where Greater Men Have Fallen“ sei ein wenig nach Schema F komponiert worden. Schade, nach wie vor nicht meins, aber auch im Kontext des PRIMORDIAL-Backkatalogs betrachtet sicherlich nicht das Beste, was diese Band je aufgenommen hat.
(6/10 | Stephan Möller)
Ich muss sagen, dass PRIMORDIAL für mich schon immer ausschließlich wegen Alan Averill interessant waren. Nicht nur ist der Mann eine Marke, dessen Interviews und die darin geäußerten Ansichten sich sehr spannend lesen lassen, auch seine Stimme und Texte sind ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der Band. Das geht jedoch auf Kosten der Kompositionen. Ich will nicht sagen, dass die Band schlechte Songs schreibt, doch erinnerte das Durchhören eines ihrer Alben immer eher an das Lauschen einer vertonten Erzählung.
Dies ist mit „Where Greater Men Have Fallen“ nicht anders – Alan steht nach wie vor im absoluten Zentrum der Songs und schlägt die Hörer sowohl mit seinen tiefsinnigen und spannenden Lyrics als auch der sehr markanten, schamanenhaften Paraphrasierung in den Bann. Zugunsten der Atmosphäre muss man jedoch bei der Arbeit der restlichen Band Abstriche machen. Denn immer wieder wirken Parts etwas zu sehr in die Länge gezogen (gleich sechs Songs überschreiten die 7-Minuten-Marke) oder klingen beliebig.
Das Album öffnet mit dem straighten, treibenden Titelsong, bei dem man sich als Fan augenblicklich zu Hause fühlt. „Where greater men have fallen – we are ready to die!“: Mit diesem Gänsehautspruch beendet Alan das Stück mit einem Ausrufezeichen. Das folgende „Babel’s Tower“ ist dagegen eine langsame und relativ schwache Schwarzmetallnummer, die mit einem unspektakulären Solo enttäuscht. Das folgende „Come The Flood“ schlägt dagegen direkt dramatische Töne an, stampft nach vorne und bietet auch endlich mal einprägsam-subtile Gitarrenmelodien, die neben der Stimme die Stärke dieser Band ausmachen. Auch hier zeigt der Frontmann sein Händchen für einfache Phrasen, die mit viel Gefühl vorgetragen eine unglaubliche Wirkung entfalten. „Let it rain!“ hat sich noch nie so episch angehört. Auch die Klimax mit Akustikgitarren am Ende des Songs ist gelungen. Und wieder prescht der Sänger vor: „Traitooooor!“ brüllt er und ein astreiner „Wolves In The Throne Room“-Song folgt in Form von „The Seed Of Tyrants“. Ein düsteres Black-Metal-Stück mit durchgepeitschten Drums und einem abrupten Ende. Das nachfolgende „Ghosts Of The Charnel House“ ist trotz massiven Riffs wieder eine mittelstarke Nummer. Darauf folgt der abgefahrenste Song des Albums. Seinem Namen „The Alchimist’s Head“ wird er auch voll gerecht – ein tödliches und wildes Gebräu wurde hier destilliert. Die sehr coole cleane Melodie am Anfang wird von einer gänzlich dissonanten Strophe durchbrochen. Alan krächzt wie Mephisto, der Bass drückt und hört sich fantastisch an. Hier wird wieder deutlich, dass bei PRIMORDIAL das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Das vorletzte Stück kratzt an den neun Minuten. Gut die ersten zwei sind ein von Gewittergeräuschen untermaltes „Geklimper“ auf einer cleanen Gitarre. Der Ausdruck soll hier positiv verstanden werden – die Passage erinnert an einen Barden, der schon vor sich hin improvisiert hat, bevor es den Blues gab. Die Band setzt mittendrin und unerwartet mit massigen Riffs ein, danach fährt der Song wieder die gewohnte Schiene. Viel mehr kommt auch nicht, denn der Rausschmeißer „Wield Lightning To Split The Sun“ ist einfach langweilig.
Und so bleibt ein durchaus positives Fazit, obwohl man das Gefühl nicht loswird, dass da mehr gehen könnte. Ich wünsche mir in Zukunft vor allem von der Gitarrenfraktion eine ausgefallenere Instrumentalisierung, damit Alans Stimme die Songs nicht ein ums andere Mal alleine tragen muss.
(7/10 | Eugen Lyubavskyy)
Galerie mit 14 Bildern: Primordial – Rock Hard Festival 2024



Mehr zu Primordial
| Band | |
|---|---|
| Stile | Black Metal, Folk Metal, Pagan Metal |
Interessante Alben finden
Auf der Suche nach neuer Mucke? Durchsuche unser Review-Archiv mit aktuell 37589 Reviews und lass Dich inspirieren!
Primordial auf Tour
| 13.09.25 | metal.de präsentiertDeath & Damnation Fest 2025 (Festival)Beherit, Primordial, Bölzer, Drudensang, Asphagor, Noctem und JesajahTurbinenhalle, Oberhausen |














 André Gabriel
André Gabriel




























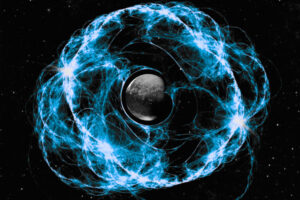



Bin hier völlig d’accord mit Jakob Volksdorf, wenngleich ich hinsichtlich der letzten 3 Alben doch nur eine 7/10 geben würde.