 1
1„Legenden sind unsterblich“, so sagt es zumindest der Volksmund. Zu den Gitarrenlegenden des Rock und Metals zählt zweifelsohne auch Yngwie Malmsteen, seines Zeichens virtuoser Schwede mit einem Ausnahmetalent für neoklassisches Gefrickel. Aber, wie „unsterblich“ im musikalischen Sinne ist ein Yngwie Malmsteen wirklich? Hat nicht auch die Traditionsspeise eines Urgestein des Heavy Metal, immer mit dem selben Rezept zubereitet, ihr Verfallsdatum? Wir begeben uns in Stiftung Warentest Manier auf eine investigative Reise durch das neue Werk von YNGWIE MALMSTEEN’S RISING FORCE, „Perpetual Flame“.
Beim äußerlichen Eindruck fällt das Produkt nach spätestens fünf Sekunden des Betrachtens ohne Schutzbrille durch. Auch wenn Yngwie mit seinen 45 Jahren nicht zum Rentner zählt, das Photoshop-Double des Gitarrenhelden mit äußerst anzüglichem Gesichtsausdruck, wallendem Brusthaar und brennendem Markenzeichen, seiner Fender Stratocaster, erregt alles Andere als meinen Appetit. Selbst hart gesottene Fans der 80er mit Pathos, Schlonz und weiß der Geier was dürften hier Magengrummeln bekommen. Ganz hart gesottene Tester können sich natürlich auch noch an das ausfaltbare Booklet wagen, Yngwie in Miami thronend auf einem Ferrari älteren Semesters verschönert garantiert jedes Wohnzimmer.
Bleiben wir bei den musikalischen Qualitäten: „Perpetual Flame“ geizt nicht mit Laufzeit, die zwölf Tracks spannen gemeinsam satte 69 Minuten Spieldauer auf, immerhin. Los geht’s mit „Death Daler“. Klar, stilecht fadet ein leiser Gitarrenkanon ein, der sich in seiner Lautstärke steigert und in schnelles Gitarrengeschreddere in jeglicher hohen und tiefen Tonlage übergeht. Das Grundtempo ist hoch, allerdings zeugen gerade die Phasen in denen der Gesang die entscheidendere Rolle spielt nicht gerade von Abwechslungsreichtum. Dagegen sind die Brücken im Songaufbau gezeichnet von Yngwies Hand an den Saiten, Sweeps und Legatos jagen präzise wie Kampfjets die Tonleiter rauf und runter, als Nichtmusiker wird mir da schon beim Zuhören schwitzig. Das Gitarre spielen hat Malmsteen also keinesfalls verlernt. Apropos Gesang: Nach dem Abgang von Doogie White hat sich Yngwie den „Ripper“ Tim Owens, nach seinem Weggang von Iced Earth verfügbar, geschnappt und hinter das Mikrofon geschnallt. Gesanglich passt dieser natürlich hervorragend zu Yngwies musikalischem Stil und auch die altbackenen Liedtexte (Krieg, Tod oder Ruhm, bla bla) sollten Herr Owens nicht allzu unbekannt sein. Von der Größenordnung muss er sich aber sowohl was die allgemeinen Anteile an den Liedern und den Stellenwert im Sound angeht viel mit Yngwie Malmsteen teilen, logisch. Das Klanggewand hat Malmsteen wieder selbst aufgenommen, keine allzu gute Idee wie ich meine. Der Sound ist ziemlich drucklos und wirkt nicht sonderlich taufrisch, auch die Stimme vom Ripper wirkt oft komprimiert und eher selten Ehrfurcht gebietend.
Zurück zu den Songs. Qualitativ bleibt Yngwie auf recht konstantem Niveau, wie viel das ist wird jeder für sich selbst entscheiden müssen. Fans von intensiven Sololäufen und verspieltem Gitarreneinsatz kommen mit „Perpetual Flame“ absolut auf ihre Kosten, dafür sorgen schon allein die „rei Instrumentalstücke, allen voran „Caprici di Diablo“, man meint fast den Geruch von Yngwies rauchenden Fingern in der Nase zu haben. „Lament“ hingegen tanzt etwas aus der Reihe, das Lied kriecht wie in Slow Motion aus dem Lautsprecher, aber natürlich werkeln auch bei diesem langsamen Grundtempo unablässig Yngwies flinke Finger an seiner Fender herum.
Auch Hörer, die sich nicht zu den bedingungslosen Anhänger der Vais, Van Halens oder eben Malmsteens zählen könnten an diesem Album Freude finden, sofern der klassisch angehauchte Metal, der sich gleichmäßig beim Heavy und beim Power bedient, keine abschreckende Wirkung auf den Gaumen, Pardon, das Trommelfell hat. Abgesehen von „Death Dealer“, das mich nicht wirklich hinter dem Kamin hervor locken kann, ist besonders „Red Devil“ ein richtig erdiger Gassenhauer geworden, die Chemie zwischen Ripper Owens Gesang und Malmsteens Virtuosität stimmt hier besonders. Die anderen Stücke sind da schon etwas epischer, sowohl Yngwies Spiel als auch Rippers Gesang sind von deutlich mehr Pathos geschwängert. Auch diese Mischung geht zwar auf, wirkt aber einfach nicht so erfrischend wie ein „Red Devil“ oder das ebenfalls interessante „Live to fight (Another Day)“.
Zeit um „Perpetual Flame“ den finalen Wertungsstempel aufzudrücken und wieder auf die Eingangsfrage einzugehen. Nein, „Perpetual Flame“ ist, vom Cover mal abgesehen, kein Fall für den Verbraucherschutz geworden, stellt für mich aber auch keinen wirklichen Meilenstein der Musikgeschichte dar. Yngwie Malmsteen wird seinen Platz in der Reihe der besten Gitarristen definitiv behalten dürfen, aber für einen hervorragenden Song und ein herausragendes Album braucht es immer noch etwas mehr, als schnelles Gitarrenspiel. Dieses letzte Fünkchen Songwriting und Originalität fehlt mir beim diesem Experiment der RISING FORCE, deshalb gibt es von mir „nur“ ein „Gut“.











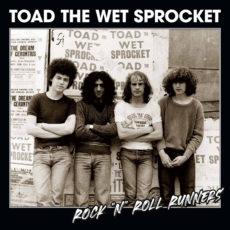

















Kommentare
Sag Deine Meinung!