
 Soundcheck September 2020# 19
Soundcheck September 2020# 19
Der große Psychedelic-Rock-Hype ist vorbei. Das Genre hat sich inzwischen eine permanente Nische eingerichtet mit leidenschaftlichen Bands und Liebhaber-Labels. Dies verringert die Inflation bei gleichbleibender Qualität. Trotzdem ist das Genre dadurch nicht frei vom Mittelmaß, wie man an WHITE DOG sehen kann. Die Geschichte der Band startet 2015, als sich ein Teil der Band auf der Texas State University traf. Unter Vermittlung der großartigen CRYPT TRIP vervollständigte sich die Gruppe. Ab diesen Zeitpunkt klingt die Bandhistorie wie ein Cheech-und-Chong-Film. Zumindest haben sich die Wolken jetzt zum ersten Studioalbum verzogen.
„White Dog“ bellt zu lang
Es ist genau der typische Psychedelic-Rock, wie man ihn als Klischeebild im Kopf hat. Mit LoFi-Produktion und einer melodiösen Lead-Gitarre, die ausufernde Soli spielt. Dabei stehen vor allem letztere im Fokus der überlangen Songs. Wie fad das werden kann, hört man deutlich in ‚Snapdragon‘, in dem die Gitarristen einfallslos vor sich hin dudeln. Das ist eine Schwäche, die sich durch das ganze Album zieht: So hat etwa ‚Lanterns‘ nicht mehr als ein prägnantes Riff zu bieten.
Dieser Ansatz sorgt dafür, dass vor allem Musiker ihre Freude hieran haben werden. Bei WHITE DOG handelt sich um studierte Musiker, die auch Fusion-Zwischenspiele in ihre Songs integrieren. Aus der Fraktion gibt es sicherlich verdientes Kopfnicken. Das Siebziger-Konzept bietet aber Ansätze zum Fremdschämen: Etwa der alberne sexuelle Unterton im Gesang zu ‚Black Powder‘ und der Kitsch-Okkultismus, der das Album durchzieht. Und der selbst gezogene Vergleich mit der ALICE COOPER GROUP hinkt gewaltig: Deren Songs waren nicht so ausufernd und tatsächlich rauer als „White Dog“.
Äußerst gesundheitsfördernd
Um es einmal kurz zu machen: Ein paar nette Riffs haben die Texaner wohl, aber letztlich erschöpft sich das in ziellosen Psychedelic-Rock. Es sind in den letzten Jahren genügend Alben erschienen, auf denen diese Art von Musik besser gespielt wurde. Somit wäre „White Dog“ eigentlich dazu verdammt, in den Untiefen der mittelmäßigen Revival-Bands verschwinden, wenn sich hier nicht eine wichtige gesundheitsfördernde Lektion daraus ziehen ließe: Drogen verbessern nicht deine Songs.

 White Dog - White Dog
White Dog - White Dog Philipp Gravenhorst
Philipp Gravenhorst 




















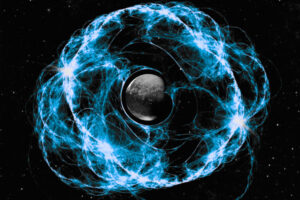









Kommentare
Sag Deine Meinung!