



Es gab diese Zeit, da glaubte jeder, Metalcore spielen zu müssen. Das hat dem Metalcore gar nicht gut getan. Und es gab die Zeit, da glaubte jeder, Post-Black Metal spielen zu müssen. Das hat dem Post-Black Metal nicht gut getan. Spätestens seit 2013 glaubt nun jeder, er müsse Elektro-, Verzeihung, Trancecore spielen. Und auch hier verbreiten sich neue Genrevertreter in ähnlich viralem Maße wie politisch fachkundige Statements von Phil Anselmo. Insofern tragen wohl auch TO THE RATS AND WOLVES viel dazu bei, den Ruf des nicht nur bei Metal-Puristen kritischen beäugten Subgenres zu schänden. Andererseits hat die deutsche Corelandschaft auch schon wesentliche unappetitlichere Toilettenschüsselgriffe als „Neverland“ erleben müssen.
Übersättigte Standard-Breakdowns, Synth-Wobbles, doppelte Mikrospitze – wer Pop-Metal will, der möge ihn auch bekommen. Dementsprechend pubertär gestalten sich Textzeilen wie „Woho, I forgot who i am, woho, I will never drink again“, aber dementsprechend muss Stücken wie „Dead By Dawn“ und „Suburban Romance“ dann auch ein angemessener Ohrwurmfaktor zugesprochen werden. Ob Autotune hier irgendwelche Hintergrundwunder vollbringt, lässt sich zwar nicht herausfiltern, aber das sollte den 08/15-Genre-Fan ja auch nicht weiter stören. Schließlich soll es ja auch immer noch Leute geben, die AMARANTHE für eine Melodic-Death-Metal-Band halten.
Ach ja – die angesprochene Hangover-Hymne „Blackout“ liest sich nicht nur auf der Tracklist wie Eins-a-Tanzflächenfutter, sondern klingt auch von der ersten Sekunde an wie die krampfhafte Vermetallung eines x-beliebigen BRUNO MARS-Songs. Aber so läuft das eben, wenn man mit dem hauseigenen KE$HA-Cover in der Vergangenheit schon knapp 150.000 YouTube-Klicks verbuchen konnte. Trotzdem traurig zu sehen, was für grausame Dinge man doch mit einem Reason-Synth-Plugin anstellen kann. Wenngleich TO THE RATS AND WOLVES auf dem selbstproduzierten „Neverland“ alles in allem für einen ziemlich satten Genresound gesorgt haben.
Schnuckelig und sympathisch zugleich, dass sich die Jungs abgesehen von eifrig besungenen Trinkeskapaden jedoch etwas gezügelter (und ernsthafter!) als ihre Castroper Kollegen ESKIMO CALLBOY geben. Klar, wer hinter „Schoolyard Warefare“ noch einen letzten Hauch lyrischer Tiefe vermutet, muss natürlich ohnehin zu viele Breakdowns in der Badewanne gehört haben. Aber immerhin ist „This is your last night, this is your last chance“ um einiges erträglicher als der pseudo-ironische Sexismus-Dreck, den CALLEJON (und alle CALLEJON-Kopien dieser Welt) so gerne absondern.
Apropos Ironie: Mit Diskomusik beschimpfenden „Every weekend, every night, it is always the same“-Psalmen entpuppt sich das Klebstoffinferno „Kill The DJ“ schlussendlich als Nemesis der Platte. „Scheiß auf die ganze Plastikmucke, gebt uns lieber Plastikmucke mit Breakdowns und Geschrei!“ Und ehe sich angesichts so viel (unfreiwilliger?!) Selbstironie die ersten Lachfältchen auftun können, wird aus allgegenwärtigen Befürchtungen dann doch noch Realität: „Check one two, Eskimo fucking Callboy is in the house.“ Tja, wäre ja auch zu schön gewesen.

 Alex Klug
Alex Klug 





















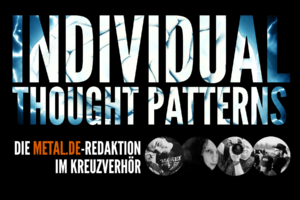







Kommentare
Sag Deine Meinung!