
Es ist schon seltsam: Da gibt es THINE seit sage und schreibe 1993 – und ich höre in diesen Tagen das erste Mal von dem britischen Fünfer. Gut, besonders viel hat die in West Yorkshire ansässige Band in den 21 Jahren nicht veröffentlicht – so ist „The Dead City Blueprint“ das erst dritte Album nach „A Town Like This“ (1998) und „In Therapy“ (2002). Ganz nach dem Motto „Was lange währt, wird endlich gut“ ist „Dead City Blueprint“ allerdings auch ein sehr gelungenes Album, das Freunde progressiven Rocks sicher zu begeistern vermag.
Wäre die Band nicht schon so „alt“, könnte ich mich glatt dazu genötigt sehen, „The Dead City Blueprint“ als Resultat eines Prozesses zu verstehen, an dessen Anfang unter anderem OPETHs „Damnation“ stand. Wie gesagt, ich könnte. Ohne die beiden Vorgänger-Alben THINEs zu kennen, bin ich mir jedoch ziemlich sicher, dass die fünf Musiker ihren Stil auch ohne die Akustik-Platte der schwedischen Prog-Götter gefunden haben – denn auch andere vermeintliche Einflüsse (wenngleich alle im progressiv und vor allem dunkel angehauchten Rock verortet) machen sich in den neun Songs bemerkbar. Ich ziehe es an dieser Stelle jedoch vor, weniger von Einflüssen zu sprechen als von Orientierungspunkten, um sich als neugieriger Hörer ein Bild von den knapp 52 Minuten zu machen.
In weitesten Teilen von „The Dead City Blueprint“ bleiben THINE akustisch – neben bereits genannter OPETH-Scheibe würde ich auch PORCUPINE TREE, ANATHEMA und KLIMT 1918 in der musikalischen Nähe sehen. Einige harmonische Kniffe würden Steven Wilson gut zu Gesicht stehen, die feine Melancholie ähnelt der des Liverpooler Cavanagh-Clans. Gegen Ende des Album („The Beacon“) kommen sogar VED BUENS ENDE- oder HEXVESSEL-ähnliche Gesangslinien auf, die – interessanterweise – von Sänger Alan Gaunt eher in Michael Stipes’scher Manier intoniert werden. Aus allen diesen Zutaten zaubern THINE einen bis auf wenige Ausnahmen höchst spannenden Dark Rock-Cocktail.
Verzerrte Ausbrüche der Gitarren sind allerdings sehr rar gesät – und wirken leider nicht ganz so wie sie es ohrenscheinlich könnten, da sie verzerrt sehr digital und wenig charmant oder auch nur organisch klingen. Das ist ausgesprochen schade, da der akustische Großteil des Album im Gegensetz eine sehr unmittelbare emotionale Dimension aufspannt. Wenn ich mir vorstelle, was für herrliche Kontraste durch einen wärmeren Klang der verzerrten Motive entstehen könnten…
Die einzige andere „Schwäche“, die ich auf „The Dead City Blueprint“ finde (aber das ist eindeutig Geschmackssache), ist die Stimme Alan Gaunts: Einerseits werde ich mit seinem Timbre nicht so recht warm, andererseits habe ich immer wieder das Gefühl, leichte Intonations-Schwächen zu erahnen – ohne genau mit dem Finger darauf zeigen zu können. Alles in allem sind solche Dinge aber Nörgelei auf sehr hohem Niveau – jeder, der sich im Prog Rock daheim fühlt und mit den beschriebenen Orientierungspunkten etwas anfangen kann, sollte sich an dieser Stelle einmal den Song „The Precipice“ anhören und sich bei Gefallen an „The Dead City Blueprint“ im Gesamtbild versuchen.
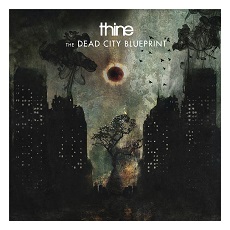
 Thine - The Dead City Blueprint
Thine - The Dead City Blueprint































Kommentare
Sag Deine Meinung!