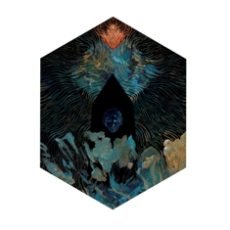Queen Elephantine - Scarab
Review
SLEEP don’t make me sleep. I say „Shalom!“ to OM.
Mit anderen Worten: Ich mag Viertelstunden-Songs, in denen (vermeintlich) wenig passiert. Prinzipiell bin ich dem Ansatz von QUEEN ELEPHANTINE auf „Scarab“ gegenüber also durchaus aufgeschlossen. Diese lassen ihre im Rock-Kontext überlangen Stücke nämlich auch ganz gemächlich vorwärts kriechen, in Zeitlupe die Richtung wechseln, auf dem Höhepunkt in einen schwerfälligen Trab verfallen bzw. – eher punktuell – hektisch galoppieren.
Die in Hongkong gegründete und mittlerweile in den USA lebende Band um Indrayudh Shome beschreibt ihren Sound selbst als „meditative blues of whirlwind ghost ships forced down the hopeless maelstroms of the Nile“ sowie „modal psychedelic doom“. Ausgedehnten sphärischen Passagen folgen harte, bisweilen dissonante Gitarren- und Bassriffs, während im Hintergrund eher dezente Drones auf der Slide-Gitarre wellenförmig die Basis bilden. Wobei diese je nach Standpunkt sowohl mit „divine mosquito“ (Homepage) als auch mit Tinnitus-Fiepen tituliert werden. Ergänzt wird dies alles über weite Strecken hintergründig durch eine indische Tanpura-Laute – und gar nicht hintergründig durch gleich zwei freigeistige Schlagzeuge, die sich mal leise, oft aber laut zwischen Tribal-Rhythmen und Rock mit Hang zur rhythmischen Anarchie austoben. Der entrückte, hypnotische Klagegesang schließlich kann als weiteres Instrument betrachtet werden und wird nur am Rande als zusätzliches Element addiert.
Das Ganze hat dabei starken Jam-Charakter und wirkt extra roh belassen, was leider jedoch nicht ausschließlich zu Lebendigkeit im Sound, sondern ebenso zu diversen mitunter leicht dissonanten, bisweilen gar kakophonischen Passagen führt. In Verbindung mit dem erwähnten klanglichen Hintergrund zwischen fernöstlicher Melodie und dezent (an den Nerven) sägenden Drone-Sounds kann das schon zu einigen Schweißperlen auf der Stirn führen. Anders als bei gekonntem Noise Rock oder deutlich konsequenterem Drone a la SUNN O))) sind diese jedoch bisweilen kein Ausdruck wohligen, kathartischen akustischen Gequältseins, sondern eher sichere Vorboten der bevorstehenden Kapitulation des Rezensenten.
Ich gestehe der Elefantenkönigin andererseits durchaus eine Reihe spannender Passagen zu, zum Beispiel wenn „Crone“ im zweiten Teil richtig Fahrt aufnimmt oder auch in Teilen des abschließenden „Clear Light Of The Unborn“. Dann packt sie mit ihrer ganzen Kraft zu und bugsiert einen vorübergehend gekonnt in den gleichzeitig entrückten wie pulstreibenden Zustand, den diese Art der Musik anstrebt. Und ich würde die Band auch gern mal live erleben – insgesamt aber überfordert mich ihr Skarabäus aus der Konserve etwas. Und zwei bis drei Semester in Spannungsbogistik hätten vielleicht auch nicht geschadet.
Andererseits: Diese Mucke zielt auf Stimmungen, nicht auf Ohrwürmer. Bin ich doch zu sehr in gängigen Schemata gefangen, um das hier ausreichend zu würdigen? Oder hätten QUEEN ELEPHANTINE an ihrem neuesten Werk tatsächlich noch etwas feilen dürfen?
Queen Elephantine - Scarab
| Band | |
|---|---|
| Wertung | |
| User-Wertung | |
| Stile | Drone, Psychedelic Rock |
| Anzahl Songs | 4 |
| Spieldauer | 50:16 |
| Release | |
| Label | Heart & Crossbone Records |
| Trackliste | 1. Veil 2. Crone 3. Snake 4. Clear Light of the Unborn |