



Benannt nach einem Enkel des legendären Dschingis Khan, haben KUBLAI KHAN zumindest im Namen einen Hauch Historie. Musikalisch dagegen ist ihr zweites Album „Nomad“ eher was für die Bühne als für die Geschichtsbücher. Vor dem inneren Auge tauchen Bilder von wackelnden Wänden sowie brutalen Moshpits auf, und auch die Violent-Dancer dürfen schon mal ihre Moves üben. Der Gedanke hat was seltsam tröstliches, denn aus Konserve offeriert „Nomad“ wenig fantasievolles.
KUBLAI KHAN: Aggressionslevel kocht auf Höchstflamme
Stattdessen kocht das Aggressionslevel auf Höchstflamme, entfaltet aber trotzdem nur die Wirkung eines stumpfen Nagels, der immer wieder in dieselbe Stelle der unnachgiebigen Wand gehämmert wird – und abzubrechen droht. Metalcore steht bei den Texanern auf dem Programm, und ohne viel Fantasie bieten KUBLAI KHAN auch genau diesen. Klar, auf „Nomad“ findet sich das eine oder andere gute Riff, aber viel zu oft hat sich das Quartett auch an der Stange bedient. Abwechslung findet eher auf Tempoebene statt, und bei den harschen Vocals bleibt trotz geringfügiger Variation eher Eintönigkeit auf dem Programm.
Demgegenüber steht allerdings die kraftvolle Produktion, welche den zahlreichen Breakdowns ordentlich Nachdruck verleiht. Auch stützt sie das brodelnde Testosteronlevel, was das Kopfkino von schwitzenden Clubs befeuert. Immerhin sind KUBLAI KHAN in den selbst sehr enggestrickten Grenzen überhaupt um Abwechslung bemüht, allerdings ohne dabei zu überraschen. So groovt eine Nummer wie „The Hammer“ ganz ordentlich und „No Kin“ lässt den Fuß im flotteren Takt mitwippen. Dass KUBLAI KHAN auch deutlich mehr Spannung fabrizieren können, zeigt sich erst am Ende, gut versteckt im Albumabschluss „River Walker“, der zunächst monoton und etwas angestaubt auf- und wiederabschwillt und schon einzuschlafen droht, am Ende aber mit flüsterndem Klargesang und einer sehr reduzierten, fast schon zärtlichen Instrumentalisierung überrascht.
„Nomad“ fehlt die Experimentierfreude
Wo auch immer „River Walker“ her kam: Ein paar mehr solcher experimentierfreudigen Momente im Gesamtbild von „Nomad“ und die Platte wäre deutlich facettenreicher ausgefallen. So bleibt es eben das oben geschilderte Problem: Live dürfte das Material explosiv sein, auf Platte bleibt die Frage: „Warum sollte ich gerade dieses Album auflegen?“

 Kublai Khan - Nomad
Kublai Khan - Nomad Jan Wischkowski
Jan Wischkowski


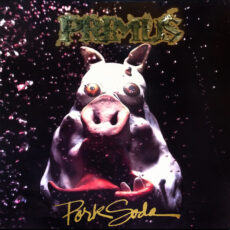





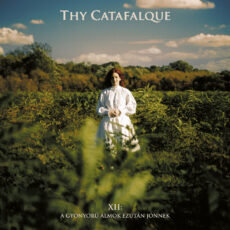

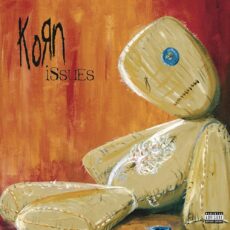




















Kommentare
Sag Deine Meinung!