

Unter "Blast From The Past" erscheinen jeden Mittwoch Reviews zu Alben, die wir bislang nicht ausreichend gewürdigt haben. Hier gibt es alle bisher erschienenen Blast-From-The-Past-Reviews.



Vorab: Manchmal wird ja kommentiert, dass in unserer „Blast From The Past“-Reihe nur echte Klassikeralben besprochen werden sollten. „Rocka Rolla“, das Debütalbum von JUDAS PRIEST, ist gewiss kein solches. Aber da wir uns hier nach und nach den Backkatalog der britischen Heavy-Metal-Legende vornehmen wollen, soll auch keine Lücke entstehen. Und „Rocka Rolla“ ist durchaus hörenswert.
Ein zweiter Punkt ist eher persönlicher Natur: Der Autor dieser Zeilen hat mit diesem Album einige Zeit verbracht. Genauer gesagt schlafend, eine Nacht im Rausch, den Kopfhörer auf den Ohren und den Walkman auf Auto-Reverse gestellt (only tape is real …), wodurch die ersten beiden PRIEST-Alben in (unter normalen Umständen) unerträglicher Lautstärke und in Dauerrotation liefen, bis die Akkus leer waren. Das war vor gut 31 Jahren im Rahmen von Abi-Feierlichkeiten – und das verbindet.
Dauerrotation, bis die Akkus leer waren
Nachdem das also geklärt ist, können wir uns den harten Fakten widmen: warum das Album kein Klassiker geworden ist nämlich, aber dennoch hörbar.
Zunächst: Als sich JUDAS PRIEST 1974 daran machten, ihr Debütalbum aufzunehmen, hatten sie beispielsweise mit den brachialen Klängen ihrer Birminghamer Kollegen BLACK SABBATH nicht viel am Hut. Daran änderte auch der Einstieg von Sänger Rob Halford und dem zweiten Gitarristen Glenn Tipton erstmal nichts. Ein Auftritt 1975 in der BBC zeigt eine hippie-eske Bluesrock-Band in Schlaghosen und bunten Oberteilen, die nur deshalb den zweiten Gitarristen mit an Bord genommen hat, um doppelstimmige Leads spielen zu können. Schaut mal hier:
Hinzu kommt, dass JUDAS PRIEST an einen Produzenten geraten waren, der vielleicht nicht die besten Ideen für ihr Debütalbum hatte. Rodger Bain war zwar eine Persönlichkeit, immerhin hatte er die ersten drei BLACK SABBATH-Alben produziert, aber nicht alle seine Entscheidungen entpuppten sich als brillant. Glenn Tipton rückte mit Stücken wie „Tyrant“, „Epitaph“ und „The Ripper“ an, die dem Produzenten jedoch nicht kommerziell aussichtsreich genug erschienen. Selbst „Whiskey Woman“, das bei Livekonzerten eine sichere Bank war, lehnte er ab. Alle Songs erschienen schließlich auf dem zweiten (und besseren) Album.
Die Aufnahmesessions gestalteten sich eher einfach: „Rocka Rolla“ wurde live im Studio eingespielt, was dem Album eine gewisse Ursprünglichkeit verleiht. Allerdings ist der Bandsound dann auch nicht so tight abgemischt, dass es beeindrucken würde. Und so müssen die Songs überzeugen, wobei es noch einen weiteren Downer gibt: Denn mangels Zeit schaffen es die Jungs nur noch, das Intro vom ursprünglich 14-minütigen „Caviar And Meths“ aufzunehmen, das schließlich als zweiminütiger Rausschmeißer herhalten muss.
Nicht kommerziell genug?
Welche Songs sind hörenswert? Zunächst einmal das Eröffnungsdoppel mit „One For The Road“ und dem Titeltrack. Ersterer Song ist ein vergleichsweise gewöhnliches Blues-Stück, dessen Fünfvierteltakt für eine gewisse Würze sorgt. „Rocka Rolla“ wiederum ist ein shuffeliger Rocker mit eingängigem Refrain und einem netten Text in Reim-Kaskaden:
Man-eatin momma, steam driven hammer
Sorts the men out from the boys
Takes no messin‘, all in wrestlin‘
Is one of her pride and joys
…
Ebenfalls nicht von schlechten Eltern ist der Bluesrocker „Cheater“, bei dem Kuhglocke und Mundharmonika nicht fehlen dürfen und Rob Halford davon singt, wie er seine Frau mit einem anderen inflagranti im Schlafgemach überrascht, ihn die Wut übermannt und er eine Pistole … – glücklicherweise haben einige Texte dann doch keinen realen Hintergrund. „Never Satisfied“ fährt etwas Heaviness auf, verbleibt ansonsten im moderaten Midtempo und wartet mit einem etwas vertrackteren Mittelteil auf – wer möchte, kann hier durchaus Progressive-Rock-Einflüsse ausmachen.
Rob Halford legt seine Stimme tiefer …
Einen starken Schlusspunkt setzt der Fünfer mit „Dying To Meet You“ – jedenfalls nachdem sich der Song aus seiner getragenen Epik befreit hat, bei dem Rob Halford die Stimme tiefer legt, um sein Vibrato noch mehr auszukosten. URIAH HEEP dürften bei diesem Song Pate gestanden haben, jedenfalls was den etwas in die Länge gezogenen Songaufbau betrifft. Im zweiten Teil des Songs schraubt Halford dann seine Stimme so in die Höhe, wie wir es aus späteren Zeiten gewöhnt sind und lieben.
Bleiben die nicht ganz so starken Songs, und da ist der Dreiklang „Winter“/“Deep Freeze“/“Winter Retreat“ zu nennen, eine dreiteilige Suite, die sich zäh und mit recht lahmer Gitarrenarbeit aus den Boxen schält. Der letzte Teil ist dabei noch am stärksten, vermittelt etwas Hoffnung und erinnert mit seinen Gitarrenarpeggien ein wenig an WISHBONE ASH oder RUSH in den sanftesten Momenten (wobei die ja erst später kamen). Ganz ordentlich ist „Run Of The Mill“, mit achteinhalb Minuten das längste Stück auf dem Album, das sich reichlich Zeit nimmt, um seine Dramatik aufzubauen – vielleicht etwas zu viel Zeit, denn richtig spannend sind die Gitarrensoli nicht alle. Immerhin wechselt Halford schließlich noch in die hohen Tonlagen und reißt raus, was geht.
Womit wir beim Thema sind: Wenn auf „Rocka Rolla“ etwas beeindruckend ist, dann der Gesang des damals noch langmattigen Sängers, der gerade in den epischen Momenten zeigt, was er kann. Die Musik ist okay, eine ganze Reihe von Songs ist durchaus hörbar und eingängig, ohne irgendeinen Klassikerstatus zu erreichen. Das liegt zu einem guten Teil an der vom Blues geprägten Gitarrenarbeit (von Heavy Metal sprechen wir hier noch lange nicht), die noch nicht sehr eingespielt klingt und durch den wenig tighten Albumsound noch weiter auseinander gerissen wird.
… und reißt „Rocka Rolla“ raus
Kurzum: JUDAS PRIEST klangen 1974 noch ziemlich unfokussiert und hatten gewiss keinen Höhepunkt gelandet – das kam erst zwei Jahre später mit dem Zweitwerk „Sad Wings Of Destiny“, wo die Band ihre Stärken deutlicher herausarbeiten und Gitarrenarbeit, Gesang und die Songs an sich noch mehr in den Mittelpunkt stellen konnte. Noch länger dauerte es, die Vertragsvereinbarungen mit dem Kleinstlabel Gull Records zu erfüllen, dessen einziges Geschäftsfeld offenbar mehr oder weniger lieblose Neuauflagen der ersten beiden Alben sind. 1977 setzten die Birminghamer schließlich die Tinte unter einen Vertrag mit der CBS, wodurch die Alben nach „Sin After Sin“ eine deutlich weitere Verbreitung erfuhren. Dies und mehr in kommenden Folgen in dieser Reihe – haltet die Augen offen.

 Judas Priest - Rocka Rolla
Judas Priest - Rocka Rolla Eckart Maronde
Eckart Maronde Judas Priest - Rocka Rolla-Jpn Card/Ltd-
Judas Priest - Rocka Rolla-Jpn Card/Ltd- Judas Priest - Sad Wings of Destiny/Rocka Rolla (+Bonus)
Judas Priest - Sad Wings of Destiny/Rocka Rolla (+Bonus)





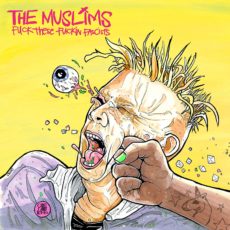

























Kommentare
Sag Deine Meinung!