 5
5Vor zehn Jahren tauchten auf dem Indie-Radar im Großraum Reykjavík eine ganze Reihe Bands von MÚM über GUSGUS bis SIGUR RÒS – um nur die bekanntesten zu nennen – auf, die sich im Laufe von nur wenigen Jahren zu einem isländischen Markenzeichen aus Experimentierfreudigkeit, Kollektivität und musikalischer Offenheit verdichteten. In der Journaille hagelte es daraufhin Verweise auf Naturmystik, heidnisches Elfengeseier, nordisches Neohippietum und ähnliche Topoi. GJÖLL (der „Lärmende“ oder „Brausende“) mit ihren aufgeregten, unberechenbaren analog-digitalen Versuchsanordnungen zwischen Song und Experiment passen da nicht so richtig ins Bild. Für den musikalischen Ansatz der Gruppe lassen sich zwar durchaus Vergleiche zu ihren isländischen Kollegen ziehen. Doch GJÖLL gehen einen Schritt weiter.
Man merkt dem Album eine sehr bewusste, analytische Arbeit an, ohne dabei den Wunsch nach möglichst organischer Atmosphäre zu vernachlässigen: Ausladend arrangierte Schichten wirken hier selten orchestral, klischeeüberbordende Stilkrücken werden weitgehend vermieden, und der Fokus liegt nie wirklich auf harmonischen Elementen. Stattdessen sind ihre Kompositionen im Rahmen einer charmanten Low-Fi-Produktion spannende Klangreisen mit atmosphärischen Brüchen, zwischen den Polen Kälte und Pathos, zwischen sterilem Soundprocessing und kantigen Beats, die zum Teil richtig aggressiven Drive entwickeln können. Von angedeuteten Melodieführungen bis hin zur garstigen Verzerrung erscheint ihr gesamtes Klangrepertoire immer unheimlich distinguiert-elegant; die Konsequenz, mit der sie ihre fiebrige Wall of Sound trotz aller Distanziertheit immer wieder so ätherisch, ja prunkvoll schmachten lassen, ist bestechend.
„Sum of Transformations“ ist – wenn man es so will – eine Postrockplatte, die aufgrund ihrer wunderbaren klanglichen Homogenität und ausladend-freien Strukturen den Errungenschaften dieser Stilart aber doch eine spannende neue Facette hinzufügen kann. Rock steht hier hinten an bzw. die Orientierung an seinen dramatischen Kniffen. Als Hörer versucht man, den vergrabenen harmonischen Elementen immer näher zu kommen, sich immer weitere Fetzen zusammenzureimen. Das Fehlen jeder Eingängigkeit erzeugt dabei einen ganz eigenen Reiz. Um Gefallen an diesem Longplayer zu finden, das sei noch erwähnt, sollte man ein unerschütterliches Faible für Wiederholung, Ereignisarmut oder auch Gleichförmigkeit mitbringen. Man muss zuhören können, um die aufgeraute Virtuosität zu verstehen, die vorzügliche Klangarchitektur zu erfassen. In den besten Momenten findet man dann dabei genauso viel Schönheit in den lärmigen Zutaten wie in den sorgsam platzierten Melodiefragmenten.






















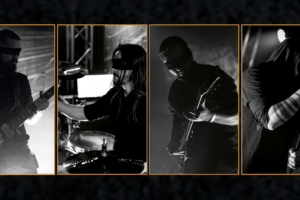










Kommentare
Sag Deine Meinung!