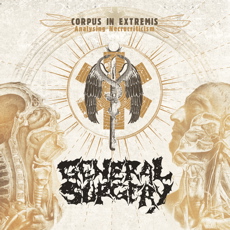General Surgery - Corpus In Extremis – Analysing Necrocriticism
Review
Wie zum Hohn auf alle Zyklentheorien, die einem musikalischen Trend eine Halbwertszeit von fünf Jahren und Künstlern eine Handvoll von Veröffentlichungen geben, bevor die Stagnation eintritt, leisten sich GENERAL SURGERY, die Schirmherren eines aktualisierten CARCASS-Sounds, den Luxus, sich wieder zur Disposition zu stellen, zwischen primitivistischen Blasts, Stockholm-Leads, schlingernden Soli, mit dem Fallbeil erzeugten Breaks und durch den Harmonizer gedrehten Röchel-Vocals ihren blutigen Gestus zu erproben. Ihre zweite Platte „Corpus In Extremis – Analysing Necrocriticism“ ist einerseits natürlich noch rollender, walzender, extremer und schneller als alles zuvor. Natürlich. Doch andererseits wirkt ihr neuer Entwurf überraschungsarm, zusammencollagiert, eklektizistisch, bemüht. Also doch Stagnation. Haut trotzdem rein.
„Necronomics“ strotzt nur so vor krauser Durchschlagkraft und unwiderstehlichem Wahn, während sich das folgende „Decedent Scarification Aesthetics“ breitschultrig nach vorne drängelt und alles von dem in den Schatten stellt, was später noch folgen soll. Denn leider sind die stumpfen und enervierend willkürlichen Songs in der Überzahl, weswegen „Corpus In Extremis“ nicht an eine Großtat wie „Left Hand Pathology“ auch nur annähernd heranreicht, sondern vielmehr, wie der Titel es nahelegt, um sich selbst kreist, ja, dauernd zu zeigen gewillt ist, was so alles geht, wenn man sich nur ganz doll anstrengt. Dass diese Schufterei, Extreme auf ihre Gelingensbedingungen hin zu untersuchen, permanent zu erkennen ist, macht das Album zu einer zwiespältigen Sache. Spätestens ab der zweiten Hälfte laufen die immer an derselben Architektur ausgerichteten Kompositionen allzu einfältig in die Leere.
GENERAL SURGERY gelingt es nicht, sich von tradierten Referenzen, überkommenen Mythen zu befreien und ihren gegebenen, schon von Hause aus engen stilistischen Rahmen zu neuen Formen zu verdichten. Sie treten auf der Stelle, anstatt in einen Prozess der Neukonfigurierung einzutreten; anstatt diesem Genre eine originelle Wendung hinzuzufügen, erliegen sie dessen prototypischen Klischees. EXHUMED betraten mit „Anatomy Is Destiny“ vor einigen Jahren eine neue Evolutionsstufe; sie haben ihrem eiterkotzenden, verdammt gut gespielten und sauber produzierten Sound eine weitere Dimension hinzufügen können, konnten eindrucksvoll aufzeigen, wie ein auf lebenslange Haltbarkeit angelegtes Riffmassaker zu grinden hat. So verheben sich die Schweden an ihrem Anspruch, auf Konsens gebügelte, vorhersehbare Ausformulierungen und Gebaren ihres Grind-Modells aufzuführen, was aber zählt, ist Verfeinerung.
General Surgery - Corpus In Extremis – Analysing Necrocriticism
| Band | |
|---|---|
| Wertung | |
| User-Wertung | |
| Stile | Death Metal |
| Anzahl Songs | 15 |
| Spieldauer | 36:12 |
| Release | 2009-03-01 |
| Label | Listenable Records |