



Beim Sichten des Archivmaterials zur Vorbereitung auf die Besprechung der neuen Platte von DANKO JONES überlief den Rezensenten ein eiskalter Schauer. Hatte er doch die 2015er-Rezension zum Vorgängeralbum „Fire Music“ tatsächlich mit Mutmaßungen über einen eventuellen Tod von Mr. Lemmy Kilmister eingeleitet und die kanadischen Traditionsrock-Fetischisten gleich mal für die eine eventuelle MOTÖRHEAD-Nachfolge angemeldet. Zwei Jahre später kratzt er schuldbewusst den Teufel von der Wand und gewinnt sich ein paar Zeilen zum neuen DANKO-JONES-Album mit dem Titel „Wild Cat“ ab. Too soon.
Aber natürlich können die Kanadier absolut nichts für das ganze Schlamassel. Die Katze lässt das Mausen nicht und die wilde Katze, die rockt halt. Elf Songs, versehen mit den gewohnten Trademarks, Jones‘ energetischer, leidenschaftlicher, überdrehter Stimme, Knarzebass, Minimalriffing und tightem Schlagwerk. Es geht um den Rock an sich und den Rock an der Frau. Deftig, nicht unsexistisch, manchmal platt und manchmal genau auf den Punkt. Überflüssig zu erwähnen, dass „Wild Cat“ das Rad nicht neu erfindet.
Wobei, gerade in der zweiten Albumhälfte servieren DANKO JONES einige geradezu offensive Anleihen bei Rockabilly („Let’s Start Dancing“) und Rock ’n‘ Roll („Wild Cat“). Dabei tanzt beim Titeltrack vor allem der Refrain aus der Reihe – in Song- und Bandkontext gleichermaßen. Darüber hinaus darf natürlich die eine oder andere Midtempo-Nummer mit Cowbell-Verzierung und der schönsten Nebensache der Welt zum Thema nicht fehlen („My Little RnR“, „Success In Bed“).
Die Sache bei DANKO JONES ist: Wenn die Songs so richtig mitreißend gelingen, dann geht man halt mit – live sowieso. Auf „Wild Cat“ ist der textlich sogar für die hier gewohnten Verhältnisse unfassbar banale Opener „I Gotta Rock“ so ein Kandidat. Im Umkehrschluss bedeutet das aber: Stimmt das Drumherum nicht, dann kommt schnell Langeweile auf – so gesehen beim ranzigen „Revolution (But Then We Make Love)“. Eigentlich schade um den Titel. Auf „Wild Cat“ passiert letzteres insgesamt leider etwas zu oft.
Der Rezensent schließt zum Abschluss die bittere Lemmy-Klammer und konstatiert, dass neue Alben von DANKO JONES nach nunmehr zwei Dekaden eigentlich dieselbe Verzichtbarkeit aufweisen, wie das MOTÖRHEAD-Spätwerk. Aber da das Adjektiv „verzichtbar“ nichts und niemandem direkt die Existenzberechtigung abspricht und man es DANKO JONES einfach gönnt, im Gespräch und im Geschäft zu bleiben, hört man halt die Singles bei YouTube und grölt live mit, wenn die Kanadier wieder in der Stadt sind. Lange wird es nicht dauern.

 Danko Jones - Wild Cat
Danko Jones - Wild Cat Tobias Kreutzer
Tobias Kreutzer 





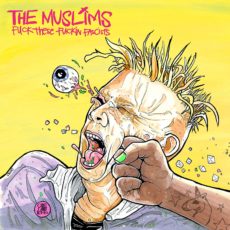

























Kommentare
Sag Deine Meinung!