

Unter "Blast From The Past" erscheinen jeden Mittwoch Reviews zu Alben, die wir bislang nicht ausreichend gewürdigt haben. Hier gibt es alle bisher erschienenen Blast-From-The-Past-Reviews.



In den frühen Neunzigern erhoben sich CROWBAR aus den Sümpfen Louisianas, um ihre gewichtigen Sludge-Spuren auf der musikalischen Landkarte zu hinterlassen. Die Band entstand, nachdem diverse andere Formationen, in denen unter anderem Bandgründer und einziges, konstantes Mitglied Kirk Windstein zuvor gespielt hat, aus unterschiedlichen Gründen zerfielen. Nachdem die Band als THE SLUGS zunächst eine Demo veröffentlichte und sich auch in diese Inkarnation auflöste, gründete man nach kurzer Pause die Band unter dem Banner CROWBAR neu. Schnell fielen die US-Amerikaner durch ihren tonnenschweren Sludge auf, auch wenn das Debüt „Obedience Thru Suffering“ zeitlebens weder kommerziellen Erfolg noch hinreichend Airplay erfuhr.
Die Sümpfe von Louisiana – und die Klänge, die sie hervorbringen
Dank der Hilfe des mit ihnen befreundeten PANTERA-Fronters Phil Anselmo sah die Sache beim folgenden, selbstbetitelten und von Anselmo produzierten Album schon anders aus. CROWBAR erhielten etwa durch MTV Headbangers Ball oder gar der Show Beavis & Butthead eine größere Publicity, sodass Songs wie „All I Had (I Gave)“ oder „Existence Is Punishment“ tatsächlich zu Hits avancierten. Und so kam die Sache mehr und mehr ins Rollen. Von hier an blieb die Qualität der Musik eine Konstante, ganz im Gegensatz zum Lineup der Band, das sich von Album zu Album praktisch immer im Wandel befand.
Die Felsen in der Brandung bildeten in der Frühphase die Gründungsmitglieder Windstein und Todd Strange, um die herum fleißig rotiert worden ist. Unter anderem wurde Mitgründer Jimmy Bower, der sich immer wieder seiner eigenen Spielweise EYEHATEGOD widmete, durch Craig Nunenmacher ersetzt, der dann wiederum durch Bower ersetzt worden ist. Auch an der zweiten Gitarre neben Windstein rotierten Namen wie Matt Thomas oder Kevin Noonan fleißig hinein und wieder heraus. Später spielte sogar Steve Gibb, Sohn von BEEGEES-Sänger Barry Gibb, in den Reihen der Band.
Der wilde Ritt auf dem CROWBAR-Besetzungskarussell
Dem zu folgen war teilweise wirklich schwer – natürlich bei weitem nicht so verwirrend wie bei KING CRIMSON zum Beispiel. Aber dennoch musste man schnell lernen, sich nicht zu sehr an die Musiker um Windstein und Strange herum zu gewöhnen. Und so kam es, dass die Gitarre neben Windstein zum Zeitpunkt ihres fünften Albums „Odd Fellows Rest“ von Sammy Pierre Duet bedient wurde, während der zum Vorgänger „Broken Glass“ wieder eingestiegene Jimmy Bower hinter den Kesseln Platz nahm und Todd Strange wie gewohnt am Bass sekundierte. Duet brachte es wie sein Vorgänger Matt Thomas auf immerhin drei Alben am Stück im Lineup.
Aber zurück zu „Odd Fellows Rest“: Was dieses Album interessant macht, ist sein ungewöhnlicher Hang zur Komplexität Atmosphäre, welche die hier vertretenen Songs zu waschechten Hinhörern macht. Damit wir uns richtig verstehen: CROWBAR klingen auf „Odd Fellows Rest“ immer noch verdammt heavy und lassen das Album zu keinem Zeitpunkt zum experimentellen Ausreißer abheben. Ihr Sound der Marke „akustische Teerlawine“ hat nichts von seiner Trägheit und schon gar nichts seiner Durchschlagskraft eingebüßt – und trotz allgegenwärtiger Tranigkeit verschwenden CROWBAR auch kaum Zeit, um dies deutlich zu machen.
CROWBAR klingen immer noch ganz wie sie selbst
Das zeigt sich vor allem daran, dass die Trackliste immer noch von einer ganze Reihe an bandtypischen Riffklumpen bevölkert wird, die mit Kirk Windsteins grober, kräftiger Reibeisenstimme ein wuchtiges Sprachrohr besitzen. In dieser Hinsicht gehört beispielsweise ein „To Carry The Load“ zu den sperrigeren Vertretern. „… And Suffer As One“ geht dagegen einen deutlich eingängigeren Weg und bleibt durch seine markigen Grooves im Gedächtnis, genau wie auch „It’s All In The Gravity“. Das Hardcore-lastige „On Frozen Ground“ geht etwas zackiger zu Werke, wartet aber mit einem gelungenen, harmonisch elegant eingefädelten Callback zum Intro des Albums auf.
Doch während diese Tracks allesamt CROWBAR-typische, hochqualitative Brecher darstellen, sind die Stars des Albums eben doch die Stücke, die mit frischen Ideen aufwarten. Vergleichsweise peppig gestaltet sich zum Beispiel „New Man Born“ dank reichhaltiger Unterstützung durch Cowbell, im Mittelteil auch durch geschäftige Perkussion, was den ansonsten recht geradlinigen Stampfer rhythmisch aufwertet und mit Leben füllt. Dazu singt Windstein hier eine der melodischeren Hooks der Platte. Subtile Effekte auf den Gitarren fügen in der zweiten Hälfte zudem noch eine angenehm fuzzige Stoner-Note in den Song ein.
„Odd Fellows Rest“ zeigt dennoch Mut für Neues
Besonders prominent sticht natürlich „Planets Collide“ hervor, das sich dem stimmungsvollen, melancholischen Intro folgend gleich mal mit atmosphärischen Melodien überraschend geschmeidig im Gehörgang des Hörers breit macht. Davon schneidet sich auch „December’s Spawn“ ein Scheibchen ab für seine eindringliche Hook, die einen angenehmen Kontrast zum sonst eher schürfenden Sludge darstellt. Den Gipfel der Eindringlichkeit erreichen CROWBAR hier aber mit dem elegischen Titeltrack, der sich schon allein durch sein cleanes Klanggewand vom Rest der Platte abhebt. Der klare, klagende Gesang fügt sich hervorragend hinein und macht den Song zu einem Höhepunkt.
„Odd Fellows Rest“ setzte die Entwicklung der Band fort, blieb den Wurzeln einerseits treu, versuchte sich aber auch an einem breiter aufgestellten Sound, was auch gelungen ist. Es ist tatsächlich eines der zugänglicheren Werke der Band, das sich hervorragend als Einstieg in deren Œuvre eignet. Und gerade die pfiffigeren Einfälle in einigen der Songs brechen die ansonsten eher sperrige Schwere zu Gunsten besserer Hörbarkeit auf, sei es durch rhythmische Spielereien oder große Melodiebögen – oder sogar getragene, stimmungsvolle Chöre wie in der zweiten Hälfte von „Scattered Pieces Lay“. Sprich: „Odd Fellows Rest“ nimmt sowohl hartkernige wie auch weniger stark besaitete Fans mit, ohne eine der beiden Fraktionen zu sehr vor den Kopf zu stoßen.
Kaum Zeit zum Verschnaufen
Für CROWBAR selbst ging es nach diesem Album natürlich nicht minder bewegt weiter wie zuvor. Todd Strange stieg nach dem folgenden „Equilibrium“ aus und kehrte der Musik den Rücken, nur um nach „Sever The Wicked Hand“ für Jeff Golden zurück zu kehren. Anders ausgedrückt: Das Lineup sollte hiernach nicht viel stabiler werden. Währenddessen trat Windstein selbst unter anderem bis 2013 als Mitglied von Phil Anselmos Sludge-Supergroup DOWN in Erscheinung und gründete mit Jamey Jasta (HATEBREED) die Band KINGDOM OF SORROW.
„Odd Fellows Rest“ erschien im Übrigen ursprünglich über Mayhem Records. Das Album wurde dann ein Jahr später via dem neuen Label der Band, Spitfire Records, neu aufgelegt und um das IRON MAIDEN-Cover „Remeber Tomorrow“ ergänzt. Das Covern von Songs war so etwas wie eine kleine Tradition der Band. Denn schon auf dem selbstbetitelten Album tummelte sich das LED ZEPPELIN-Cover „No Quarter“, während „Equilibrium“ das Gary Wright-Cover „Dream Weaver“ enthielt. Wobei die Band den Sound der Cover-Songs natürlich ihrem eigenen Gusto anpasste…
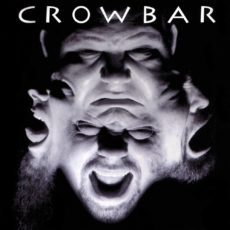
 Crowbar - Odd Fellows Rest
Crowbar - Odd Fellows Rest Michael
Michael Crowbar - Equilibrium & Odd Fellows Rest
Crowbar - Equilibrium & Odd Fellows Rest



















Eine der wenigen sludge bands, die ich mir ab und zu geben kann. Sonst find ich die musik eher langweilig, aber die riffs sind halt so breit wie kirk windstein selbst, so macht leiden spaß.
Mir geht dieser inflationär bemühte Begriff Sludge mittlerweile auf die Nerven und fragte man Kirk, so käme dieser gewiss nicht als Erstes auf den Gedanken seine Mucke damit zu titulieren, andererseits haben speziell die ersten drei Crowbar Scheiben eben jenes zähes, gemeines und fieses Moment durchaus auch in sich. Aber wie dem auch immer sei, war ich nach der Großtat Broken Glass einfach erstmal enttäuscht, denn zu warm, zu wenig brutal und way too fuzzy waberte die gegenständliche Pladde aus meiner Anlage und bis heute ist es ‚Planets collide‘, der es in so gut wie all meine Playlists geschafft hat. Das Album als ganzes höre ich mittlerweile gerne zum Runterkommen und blende es anders, als das für mich furchtbare Equilibrium nicht komplett aus.
Man munkelt ja, Metallica hätten ihr (echt hässliches) Cover-Artwork für „Hardwired…“ von Crowbar geklaut.
Beide cover gewinnen keinen schönheitscontest und wirken wie fotocollagen direkt vom lokus, nachdem man die frage des inders, ob man wirklich „scharf“ bedtellen will, mit einem überzeugten „ja!“ beantwortet hat.
Auf die Gefahr hin, dass das Thema wieder völlig abdriftet: Ich habe schon öfter richtig scharf gegessen und hatte danach nie irgendwelche „Lokus-Probleme“. Aber angeblich sind die ja doch ganz schön verbreitet. Und um die Kurve zu kriegen: Ja, schön ist auch das Crowbar-Cover nicht.
Schärfe ist ja auch eine gewöhnungssache, wobei scharf beim inder nochmal eine ganz eigene qualität hat. Aber wie auch immer, die cover sehen beide nach kampf auf dem donnerbalken aus.
Also als sehr scharfes Essen goutierender Mann mit schönem, dicken Bauch, der diese dicke Musik liebt, kann ich euch aufgrund aktueller Studienlage schreiben, dass in Ländern, in denen sehr scharf gegessen und zudem in der Hocke in den bodennahen Lokus geschissen wird, Darmkrebs so gut wie nicht vorkommt. Ein weiterer Vorteil: Eine Crowbar wird bei zu erwartender Stuhlfrequenz und -konsistenz gewiss nicht gebraucht (ich kann nicht fassen, das ich den wirklich bringe)
Daher auch die Redensart „brennt zweimal“. Concrete Winds sind da natürlich ausgeschlossen….
Waren das nicht die mit der Symphonie der Verstopfung?
Sludge, doom, doomcore, gehopst wie gesprungen. Langsame, schwemütige, breitwandige mucke halt. Oder wie ein gewisser jemand vielleicht pauschalisierend sagen würde: dicke musik für dicke männer. Ich mags jedenfalls, auch weil crowbar im gegensatz zu vielen ähnlichen bands ein gespür für dynamik haben.
so klingt nur Kirk, Crowbar ist Musik von und für leidende Männer, ich fühle mich sehr aufgehoben hier 🙂
Ich hör Crowbar immer, wenn ich Schnupfen hab 😉