



Manche Bands sind wahrhaftig schwer in eine Schublade zu stecken. Entweder sie weisen einen eklektischen Sound auf so wie etwa SIGH – man höre deren 2018er Album „Heir To Despair“ – oder aber sie springen wie ein Flummi von Album zu Album zwischen mehr oder weniger etablierten Sounds hin und her wie deren hier gegenständliche Landsmänner und -frauen BORIS. Die japanische Kult-Formation hat einen derart unübersichtlichen Backkatalog angehäuft, dass eine vollständige Auflistung ihres Œuvres vermutlich eher wie eine Aufgabe für die Philologie anmutet. Zwischen Stoner-/Doom Metal, Ambient-Spielereien und wahrhaftig experimentellen Ausflügen wie zum Beispiel auch ihre Kollaboration mit MERZBOW, „Gensho“, weiß man vermutlich nie ganz von vorn herein, was man bei dem Trio bekommt.
Eine der großen Wundertüten des japanischen Metals liefert wieder
Nun fügen sie ihrem „Heavy Rocks“-Zyklus einen weiteren Eintrag nach der 2002er und 2011er Version hinzu – und diesmal drehen BORIS richtig auf. Nun wirbeln sie unter diesem Banner Staub auf mit ihrer vielleicht wildesten „Heavy Rocks“-Fahrt, bei der sie ihre Füße vergleichsweise selten ganz vom Gaspedal entfernen und einige heftige Klopper abfeuern. Ein solcher ist gleich mal der Opener „She Is Burning“ und überrumpelt die Hörerschaft, ohne vorher höflich anzuklopfen. Gleichzeitig finden einschlägige Noise-Rock- und eine ebenso markige Hardcore- bzw. Sludge-Noten ihren Weg in den Sound und tragen zur titelgebenden Heaviness bei, auch wenn es auf Songs wie „Blah Blah Blah“, „(Not) Last Song“ und dem Mittelteil von „Question 1“ durchaus mal etwas stimmungsvoller und melodischer wird.
Die gegenständlich Darbietung der drei Musiker kann man im Grunde mit dem Wort „schweißtreibend“ treffend umschreiben. „Heavy Rocks (2022)“ klingt direkt und fast wie aus dem Moment entsprungen, wie die spontane, energiegeladene Performance einer perfekt aufeinander eingespielten Rock-Band, die in ihren intensivsten Momenten einfach nur mal so richtig alles und jeden rasieren möchte. Man stelle sich das nur mal in einem Live-Setting beispielsweise in einem schummrigen Club vor. Wata, Takeshi und Atsuo lärmen hier teilweise so ungehobelt, als hätten sie die Hardcore-Essenz der „Blood Mountain“-MASTODON heraus destilliert und in einen rotzigen Live-Sound á la CORROSION OF CONFORMITY reingestopft.
„Heavy Rocks“ ist Programm
Das überträgt sich auch auf die Sludge-lastigeren Stücke, in denen sie das Tempo herunterdrehen und ihre Hörer in einer Teergrube untergehen lassen, wie in „Nosferatou“. Doch die intensivsten Momente erlebt man hier wahrhaftig dann, wenn die Japaner richtig aufdrehen. An der Gesangsfront herrscht dann ein wildes Gebrülle, Gerufe und Gekreische vor, das teilweise fast chaotisch punkige Züge annimmt – inklusive gelegentlicher Gangshouts wie in „My Name Is Blank“ oder „Ruins“. Mal wird die Groove-Schraube angezogen wie im Rock n‘ Roll-lastigen Opener „She Is Burning“ oder im seltsam Boogie-artigen „Cramper“. An anderer Stelle wird wild drauf los geknüppelt wie in „Ruins“ oder in „Chained“.
Ihre Experimentierfreude lassen BORIS dabei nicht außer Acht, sondern nutzen sie lieber, um ihre intensiven Sounderuptionen interessant auszukleiden, entweder eben durch schräge Spitzen wie das Saxofon, das bei „Nosferatou“ jazzig und keck dazwischen quakt, oder wie die bollernden Industrial-Beats in „Ghostly Imagination“. Oder sie verpassen ihrem Sound etwas Originelles durch interessante Texturen, die sich entweder in Form einer Kombination von Synths und klar gesungenen Backing Vocals unter den Krach legen wie in „Chained“, um dort von aufmerksamen Hörern entdeckt zu werden, oder eben durch flächig arrangierte Klanggeflechte, die angenehm unter die Haut gehen und oftmals auch das Tempo gewinnbringend aus dem Sound nehmen („Question 1“).
BORIS machen das Chaos zur Ästhetik
Der Rausschmeißer „(Not) Last Song“ ist dann eine packende, vom Klavier getragene Nummer, die das vorangegangene Programm komplett kontrastiert. Man kann vielleicht das Klavierspiel zu Beginn und um die 4:23-Marke als etwas zu simpel ankreiden, aber die dank Noise- und Ambient-Elementen geleistete Stimmungsarbeit drum herum klärt eigentlich ganz gut. Eine Sache stößt hier allerdings definitiv sauer auf: Der Song hört einfach abrupt auf und hat kein richtiges Ende, so als wäre er versehentlich beim Mixen so mitten im Takt, ja: mitten in der Gesangslinie abgeschnitten worden. Ansonsten lassen sie sich hier aber wirklich wenig zu Schulden kommen.
Die teilweise etwas chaotisch wirkende Produktion passt hier wie Arsch auf Eimer und untermalt diese wilde Fahrt umso mehr. Und die Abwechslung, die sie hier rein gebracht haben, sorgt für eine angemessene Langlebigkeit der Platte, sodass es in diesem über weite Strecken wüst lärmenden Riffklumpen doch tatsächlich einiges an interessanten Details zu entdecken gibt. In den ersten Durchläufen ist man aber wahrscheinlich ohnehin eher damit beschäftigt, die eigene Omme freudestrahlend im Takt nicken zu lassen, während die Gliedmaßen wild herum schlackern.

 Boris - Heavy Rocks (2022)
Boris - Heavy Rocks (2022) Michael
Michael Boris - Heavy Rocks (2022) - Gold Vinyl [Vinyl LP]
Boris - Heavy Rocks (2022) - Gold Vinyl [Vinyl LP]






















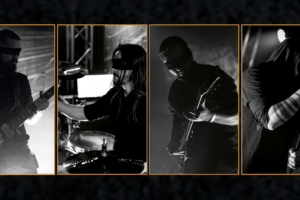








Kommentare
Sag Deine Meinung!