 5
5Die Musik der Österreicher BLACKBURN zu charakterisieren, ist nicht ganz einfach. Klar, Alternative Rock, aber was heißt das schon? Am ehesten rückt man ihrem Sound auf den Leib, wenn man sich folgende Situation vorstellt: Jerry Cantrell (ohne Staley, der ist ja leider tot), Ritchie Blackmore (der junge, ohne diesen Mittelalterfirlefanz) und Brandon Boyd (INCUBUS) fallen, nach einem Funk-Konzert ordentlich angetrunken, in Billy Corgans Garage ein, um eine ausgedehnte, von Dope und Wehmut schwangere Jamsession zu starten.
So vielversprechend das gezeichnete Bild ist, Abstriche muss man bei „Blackburn“, dem – logisch – selbstbetitelten Album der Band machen. Wenn sie dem Genre treu nacheinfern und in ihm aufgehen wie im Mutterbauch, sind sie wirklich gut. Sänger Gonzos etwas näselnde Stimme bedarf zwar einiger Gewöhnung, kann aber durchaus Akzente setzen. Besonders der Opener „Disease“ zeigt die Stärken der Band: Ein auf den Punkt gebrachter Rocksong mitsamt Hammerchorus, der ebensogut auf INCUBUS‘ „Morning View“ seine Berechtigung gehabt hätte. Schwierig wird es für die Musiker-Hörer-Beziehung, wenn BLACKBURN anfangen zu experimentieren. Allzulange Instrumentaljams stellen eigentlich knackige Nummern auf den Kopf und sich dem Hörer in den Weg, wenn es darum geht, den Sound der Band vollends zu fassen. Dass es sich bei dreien der Stücke um Liveaufnahmen handelt, fällt nicht weiter ins Gewicht, der Sound steht den Studioaufnahmen in nichts nach und das Publikum wird auch hörflussfreundlich übergangen.
Auch wenn BLACKBURN eine gute Alternative-Platte gelungen ist, vom Hocker reißt ihre Performance noch niemanden. Der Spielraum für Verbesserungen äußert sich vor allem in Form von einem fehlenden Sinn für Dramatik, der gerade die Grunge-nahen Anteile auf „Blackburn“ deutlich hervorstechender hätte formulieren können. Dass besagte Luft nach oben mit dem weiteren musikalischen Schaffen der Band ausgenutzt wird, soll an dieser Stelle jedoch nicht bezweifelt werden.
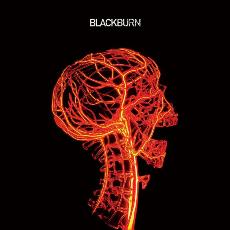
 Blackburns - The Blackburns
Blackburns - The Blackburns Blackburn, Brian - Blackburn, Brian Lou Steel 7" Pye 7N 46005 EX1977
Blackburn, Brian - Blackburn, Brian Lou Steel 7" Pye 7N 46005 EX1977 Blackburn Cathedral Choir - Christmastime at Blackburn
Blackburn Cathedral Choir - Christmastime at Blackburn Maurice Blackburn - Maurice Blackburn - Filmusique/Filmopera
Maurice Blackburn - Maurice Blackburn - Filmusique/Filmopera




















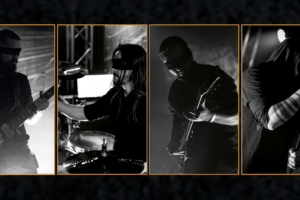










Kommentare
Sag Deine Meinung!