
Alte Röhren klingen einfach geil. Ihnen fehlt die Reibungslosigkeit und Glätte der modernen Welt sich automatisch öffnender Lifttüren, sie verströmen den Duft von Störrigkeit, sind widerspenstig und bedürfen daher der Spezialkenntnisse von Maschinisten, die ihre Macken – die sie liebevoll Charakter nennen – kennen und sie ölen. Komisch, aber irgendwie folgerichtig, dass die Mechanisierung des Lebens in dem Moment wieder den Geschmack von Lebendigkeit auf die Zunge spült, in dem sie durch eine weiter fortschreitende technologische Entwicklung selbst historisierbar wird.
Die amerikanischen Rock-Gladiatoren AKIMBO versuchen eine ganze musikalische Karriere auf dieser Schönheit ausgestorbener Röhren-Amps zu errichten; bei ihnen stehen die Zeichen auf Intensität statt Komplexität, sie zerlegen ihren aufs Wesentliche heruntergestrippten Rock in so handliche wie grobe rhythmische Einheiten. Man will weg vom vermeintlichen Authentizismus des Schwanzrock und den aufgeblasenen Gitarrensoli komischer langhaariger Möchtegernvirtuosen. Das ist die Motivation des Punk, die AKIMBO hier beerben. Lieber Ü-Raum als Akademie, lieber Dreck als Glitter, bloß nicht das Instrument zu gut beherrschen, so weit es geht, alles selbst machen, statt einen pangalesischen Marimbaphonisten einfliegen zu lassen. Man will nicht in die Kälte einer Moderne, in der der klinisch-uterale Beat, den man das erste Mal in Frau Mutters Fruchtblase hört und der dich als eigener Herzschlag so lange du lebst nicht mehr verlassen wird, zur bloßen entmenschten Klanglandschaft verdampft.
Das musikalische Fundament mit seiner ritualisierten Konzentration auf konstante rhythmische Figuren und die unmittelbare Präsenz des Gesangs, ist weitgehend von rockistischen Absurditäten freigehalten worden. AKIMBO konzentrieren sich auf die suggestive Wechselwirkung zwischen Percussion und Riff, auf die malochermäßige Auseinandersetzung mit dem reinen Klang, auf das Physische des subsonischen Wumms. Ein stetes Hin und ein Her, ein Rock und ein Roll und ein Metal, nudistisch heruntergekocht. Nur dass dieses sich zu einer gewissen Trance aufbauende Hauruck einer Dynamik unterstellt ist, die nach ganz irdischem Sex klingt. Schwitzig und dirty, ein bisschen hysterisch, ein wenig hyperventilierend.
Ein weiteres, auf „Jersey Shores“ dominierendes musikalisches Moment ist ihre zermürbende Heavyness. Das zwölfminütige Titelstück oder das nicht minder lange „Lester Stillwell“ bestehen aus einem einzigen, langsam vorantreibenden Riff, das in unterschiedlichen motivischen und dynamischen Variationen präsentiert wird. Darüber legen sich sparsam gesetzte atonale Gitarrenfiguren, Knacklaute, die auf defektes Equipment schließen lassen und knarzende Bassattacken, bestehend aus zwei maßlos verzerrten Singlenotes. Interessant ist das klangliche Erscheinungsbild, das durch geschickte Manipulationen den Eindruck fließender Kontinuität vermittelt.
Bei „Great White Bull“ wird zwar das Tempo angezogen, das Prinzip ist allerdings identisch. Erneut sägt sich hauptsächlich nur ein Riff durch ein Hölle aus kochenden Verzerrungen, bricht mittendrin weg, gibt Feedbacks Entfaltungsraum, nur um dann noch intensiver und härter wieder in Erscheinung zu treten als vorher. Und wenn man die Augen schließt, dann sieht man zu den rumpelnden Bässen, sparsam eingesetzten Gitarrensalven und mehr stakkatohaft gesprochenen, geschrieenen und skandierten als gesungenen Vocals auf „Jersey Shores“ irgendwas bedrohliches aus den Untiefen der Ozeanologie: Thematisch geht es um die Haiattacken an den Stränden des Garden State, vom 1. bis 12. Juli 1916, die nachhaltig das Bild vom Hai als Versinnbildlichung des Meerungeheuers prägten.
„Jersey Shores“ präsentiert AKIMBO auf dem Höhepunkt ihrer kreativen Kräfte und beweist, dass der amerikanische Noise-Underground nicht ausschließlich aufgrund seiner Produktions- und Distributionswege von einer fraglichen Beliebigkeit erfüllt ist, sondern auch nach wie vor interessante Bands hervorbringen kann, deren musikalische Programmatik einem Schlag in die Magengrube gleichkommt. Es ist ein ernstzunehmendes Statement für die Nachhaltigkeit aktueller amerikanischer Musikkultur.
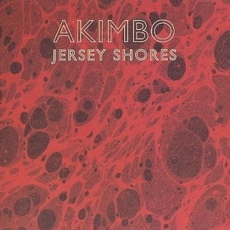
 Akimbo - Jersey Shores
Akimbo - Jersey Shores





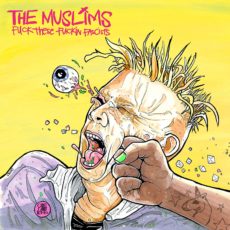

























Kommentare
Sag Deine Meinung!