
 Soundcheck November 2024# 2
Galerie mit 28 Bildern: Sólstafir - Summer Breeze Open Air 2025
Soundcheck November 2024# 2
Galerie mit 28 Bildern: Sólstafir - Summer Breeze Open Air 2025


Bis einschließlich „Ótta“ schien es, als hätten SÓLSTAFIR nie etwas falsch machen können. Begonnen im raueren Black/Viking Metal mit dem legendären Debüt „Í Blóði Og Anda“ und der beginnenden Metamorphose auf dem möglicherweise noch lengendäreren Zweitling „Masterpiece Of Bitterness“ etablierten sich die Isländer um Aðalbjörn Tryggvason als Meister der majestätischen Stimmungsmache mit dem einzigartigen Sprachrohr des Fronters, das sich mehr und mehr dem klaren, klagenden Gesang öffnete, und stellten dies in den Folgewerken „Köld“ und „Svartir Sandar“ ohne Fehl und Tadel unter Beweis. Und dann, nach „Ótta“, kamen „Berdreyminn“ und „Endless Twilight Of Codependent Love“ – und plötzlich war sich die Metal-Welt gar nicht mehr so einig über die Qualität dieser Formation.
Suchen SÓLSTAFIR nach ihrer neuen Mitte?
Diesseitig wurden diese beiden Werke zwar unverändert euphorisch aufgenommen, an anderer Stelle wurde jedoch zunehmend eine Band beschrieben, die sich öfter in zu ausgedehnten Beliebigkeiten zu verlieren schien – vermutlich mehr auf „Berdreyminn“ als auf „Endless Twilight Of Codependent Love“. Mit diesem Tenor im Ohr scheint es fast logisch, dass nun, anno 2024, mit „Hin Helga Kvöl“ das mit Abstand kürzeste Album der Band in die Ladenregale Mediatheken der Streaming-Dienste Eures Vertrauens segelt. Doch nicht nur ist die Prägnanz dieses Releases auffällig. Mehr noch scheint es, als unternehmen die Isländer hier so etwas wie einen Selbstfindungstrip. Denn „Hin Helga Kvöl“ tastet sich in alle möglichen Richtungen voran.
Man möchte dabei nicht soweit gehen und dem Album eine Zerfahrenheit unterstellen, da unter alledem noch deutlich die zeitgenössischen SÓLSTAFIR eindeutig identifizierbar sind. Das charakteristische Kunstjaulen von Tryggvason über meist Post-Rock-infundierte Klänge bleibt das Kernelement, der Dreh- und Angelpunkt dieser Veröffentlichung. Aber irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass hier so ein „Quo Vadis“-Moment vorliegt. Auf der einen Seite stehen Tracks wie das E-Bow-schwangere „Salumessa“, das in seiner kontemplativen Getragenheit fast schon etwas zu sehr nach reinem Post-Rock klingt, auf der anderen Seite gibt es urtümliche Black Metal-Eruptionen in Form des Titeltracks. Aber irgendwie kommt beides nicht so richtig auf einen Nenner.
„Hin Helga Kvöl“ lässt den roten Faden missen
Will sagen: Ein bisschen misst unsereins den roten Faden. Die kürzeren Trackspielzeiten haben da nur bedingt mit zu tun, es ist eher die Natur des Songwritings, das ständig hin und her springt. Während der Opener „Hún Andar“ den typischen SÓLSTAFIR-Sound der „Svartir Sandar“-Tage in Form eines mundgerechten Häppchens darreicht, geht es auf „Blakkrakki“ rockiger zu mit leichtem Gothic-Einschlag. „Freygátan“ klingt fast wie eine Power-Ballade aus den Arenen der Achtziger inklusive schmachtendem Gitarrensolo am Ende, das so klingt als hätten die Isländer im Vorfeld etwas zu viel AEROSMITH gehört.
Und dann springt das Album zwei Tracks weiter mit „Nú Mun Ljósið Deyja“ wieder zurück in den Schwarzwurzel-Modus, aber mit mehr Fokus auf Atmosphäre und einem reichhaltigen Post-Rock-Einschlag. Mit dem Rausschmeißer „Kuml“ gibt es dann eine dicke Überraschung. Hier lassen die Isländer die Atmorphäre dann doch mal für sich sprechen in einem Song, der dank dem Saxofon von Gastmusiker Jens Hanson ein fast urbanes Feeling inne hat, als wollte man das abendliche Treiben in einer schummrigen Bar irgendwo in der Großstadt darstellen. Einige ominöse Gesänge später ebbt der Metal-Anteil dann noch mal für ein grandioses Finale letztmalig auf, bevor sich der Song dann samtig auflöst.
Am besten sei das Album als eine Werkschau der Isländer betrachtet
Unsereins ist hin- und hergerissen. Für sich genommen ist das Songmaterial gut bis sehr gut. Es gibt kaum Ausfälle zu vermelden, vielleicht am ehesten noch „Vor As“, das als qualitatives Schlusslicht gesehen werden kann. Aber selbst hier reißen die Isländer gegen Ende das Ruder dank der Inkorporation von weiblichen Backing Vocals wieder einigermaßen rum. Aber das Album als Ganzes fühlt sich eben mehr wie eine Werkschau denn ein in sich geschlossenes Werk an. Wenn man bedenkt, wie konzis SÓLSTAFIR in der Vergangenheit geklungen haben, fühlt sich „Hin Helga Kvöl“ ein bisschen wie ein Downgrade an. Andererseits meckert man da auch auf extrem hohem Niveau. Schwierige Sache das … Vermutlich sei die Platte aufgrund ihrer Prägnanz am ehesten mit vorsichtigem Optimismus an all jene empfohlen, denen die beiden Vorgänger wenig bis nichts gegeben haben …

 Sólstafir - Hin Helga Kvöl
Sólstafir - Hin Helga Kvöl Michael
Michael


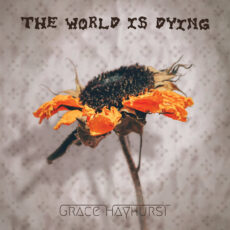

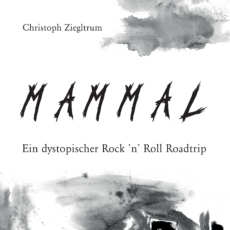

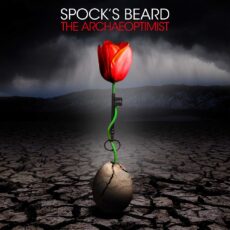
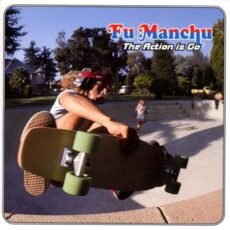























Ich möchte jetzt nicht das Fass wieder aufmachen, aber es wird deutlich, dass die Band seit dem Abgang ihres ursprünglichen Drummers nicht mehr so gut ist. Otta war noch Mal ein großes Highlight, danach gingen bei mir aber die Sympathien total flöten und auch ein sehr seltsamer Liveauftritt, wo man die Unzulänglichkeiten im Gesang noch wesentlich deutlicher gemerkt hat, war da jetzt nicht zwingend hilfreich.
Schade, bis Otta habe ich die Band wirklich geliebt, seitdem kann sie in meinen Ohren nichts mehr richtig machen. Liegt es an der Band oder an mir? Ich vermute letzteres, scheinbar bin ich aber nicht der einzige, der bei Solstafir leider raus ist.
Ich denke, dass die Trennung vom Drummer alternativlos war. Letztes Jahr fiel er auf seinen sozialen Kanälen wiederholt mit antisemitischem Geschwurbel auf, auch wenn er das in einem Statement abgestritten hat und seitdem kleinere Brötchen bäckt.
Davon ab: Mir gefallen Sólstafir immer noch sehr gut, die aktuellen Singles klingen vielversprechend. Passt jetzt auch wieder perfekt zur Jahreszeit.
Was hat Gummi von sich gegeben? Ich hab mal bisschen gesucht, konnte aber nichts finden.
Dazu wirst du jetzt auch nicht mehr viel finden, weil er mit besagtem Statement seine privaten Accounts gelöscht hat und somit das gesamte Geschwurbel natürlich auch verschwunden ist. Gelegentlich meldet er sich noch mit dem Band-Account seines Kuggur-Projekts, aber eben, wie gesagt, deutlich gemäßigter.
Kannst du mir dann sagen was er gesagt hat? Ich mag den eigentlich total gerne!
Ich habe das über ein Jahr später nicht mehr im Kopf, weil ich das irgendwann einfach nicht mehr ernstnehmen konnte und mich ausgeklinkt habe. Was ich aber weiß, ist, dass er gefühlt alle 30 Minuten irgendeinen neuen Post über die Situation um Israel und Gaza abgesetzt, dabei Fake-Videos geteilt und antisemitische Propaganda verbreitet hat. Dann war es wie immer: Kritik kam, der arme Gummi meinte, man habe ihn lediglich falsch verstanden, die Accounts wurden eingeschränkt/gelöscht. Same procedure as every year, James. Ich kann diese Clowns, die sich bei jedem Krieg und bei jeder Krise zu Predigern aufschwingen und die einzige Wahrheit für sich gepachtet haben wollen, beim leisesten Hauch von Gegenwind dann aber einknicken bzw. in die Opferrolle flüchten, einfach nicht mehr ernstnehmen.
Alles klar.