



Wir kehren mal gedanklich kurz zum abschließenden Track des Voralbums „Phanerozoic II: Mesozoic | Cenozoic“ zurück. Dieses nämlich endete seinerzeit mit dem Song „Holocene“, einem Stück, das aufgrund seiner Synth-Texturen und seiner generell eher ruhigen Art vom Rest des besagten Albums hervorstach. Knapp drei Jahre später liefern THE OCEAN das dazugehörige, gleichnamige Album nach, das soundtechnisch dort anknüpft und die ruhigeren, texturierteren Klanglandschaften weiter erkundet, die urgewaltigen Sludge- und Post-Metal-Anteile etwas einreduziert und die Atmosphäre mehr in den Mittelpunkt rückt. Robin Staps selbst bezeichnete den Entstehungsprozess dergestalt, dass das Songwriting oft mit einer Idee von Peter Voigtmann (Synthesizer) begann und von dort aus entwickelt worden ist, nicht wie vorher üblich mit Riffs, Gesangslinien oder Drumbeats. Wir befinden uns nun erdgeschichtlich so gut wie in der Gegenwart.
Im Holozän angekommen – THE OCEAN musizieren sich in die Gegenwart
Den Sinn für dramaturgische Songbauten haben Staps‘ Metal-Paläontologen trotz der Reduktion ihrer zupackenderen, musikalischen Elemente und den zum Großteil durch klaren Gesang dominierten Stücken beibehalten. Die Clean Vocals von Loïc Rossetti sind üblicherweise zweckdienlicher Natur, wachsen aber vor allem in den mehrstimmigen Passagen über sich hinaus. Der Opener „Preboreal“ macht es eindrucksvoll vor und bringt sämtliche Stärken des Albums programmatisch auf den Punkt. Sanft und stimmungsvoll pulsierende Synths geleiten den Hörer durch einen Track hindurch, der die zumeist eher gedämpfte Charakteristik des zeitgenössischen THE OCEAN-Sounds sinn- und geschmackvoll vorstellt, sich dabei aber in sein intensives, in Sachen urtümlicher Härte jedoch weiterhin zurückhaltendes Finale steigert. Es ist einer dieser typischen, atmosphärisch unglaublich dicht gewobenen Songs, in denen man sich als Hörer regelrecht verlieren kann.
Generell gefällt der Einsatz von Synths auf den ersten beiden Tracks besonders, es verleiht „Preboreal“ und dem folgenden „Boreal“ aufgrund ihrer recht düsteren Einfärbung einen einschlägigen Gothic-Anstrich, etwas was schon beim Vorgänger immer wieder hervor diffundiert ist. „Boreal“ folgt „Preboreal“ erwähntermaßen auf dem Fuße und zeichnet sich durch diese deutlich sinnierender pulsierenden Synths aus, welche die gesamte Fußarbeit in Sachen Stimmung machen. Der folgende Metal-Ausbruch gerät zunächst ein bisschen unbefriedigend; die zunächst einsetzenden Bratriffs sind entweder viel zu einfältig oder deren Inszenierung nicht gigantisch genug, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Das ändert sich erst nach und nach, wenn die Eruption an Intensität zulegt.
Zwischen Synths, Electronica und Metal-Bollwerken
Von diesem kleinen Schluckauf erholt man sich allerdings recht zügig wieder mit „Sea Of Reeds“, das sich mit seinen vielschichtigen Klangtexturen komplett auf die gedämpfte Atmosphärik konzentriert, bevor „Atlantic“ wieder großes, dramaturgisches Kino zur Schau stellt. Sich zunächst wieder auf amtosphärischen Wege anschleichend inklusive elektronischer Beats, geschmackvollen Saxofon-Licks und sogar einiger chromatischer Perkussion, die immer wieder durch den Song flirrt, baut sich der Song langsam aber sicher auf, lässt bereits früh anhand von ominösen Gitarrenmotiven erahnen, dass sich ein Sturm nähert. Dieser fällt zwar nicht annähernd so ungemütlich aus wie in den früheren Werken der Band, bildet aber dennoch eine angemessene Klimax für den Track.
Bis hierhin bleibt „Holocene“ bei den etablierten Sounds, ohne zu sehr davon abzuweichen. Das ist nicht negativ zu verstehen, vielmehr ein Attribut der Konsistenz, mit der THE OCEAN hier operieren. So richtig experimentell wird es tatsächlich erst in der zweiten Albumhälfte, die mit „Subboreal“ eingeleitet wird. Den Beginn macht ein Part mit elektonischem Beat und wieder dieser gotischen Vibes, die bereits zu Beginn prominent aufgetaucht sind sowie fast poppigen Gesangslinien, die dann aber in einen Modern Metal-artigen Djent-Light-Part überführt werden, fast als wollte man einen zeitgemäßen Metal-Hit produzieren. Hier wird es erstmals in der Laufzeit von „Holocene“ auch richtig ruppig, was Härte angeht.
THE OCEAN bringen in der zweiten Albumhälfte die tektonischen Platten wieder ins Wanken
„Unconformities“ ist ein online bereits ordentlich diskutierter Track. Einer der Gründe ist, dass die Standalone-Vinyl-Pressungen ohne diesen Track daher kommen. Das ist fast schon eine Schande, denn es handelt sich hier um eines der großen Highlights der Platte. Denn „Unconformities“ ist eine Kooperation mit Karin Park, die im ersten Teil des Neunminüters den Gesang übernimmt. Die Musik nimmt hier leichte MADDER MORTEM-Facetten an, Parks Gesang schwebt elfengleich darüber und es hat eine geradezu betörende Wirkung auf des Hörers Gemüt. Der Übergang zwischen dem ersten, von Park besungenen Abschnit, und dem zweiten, Post-Metal-infundierten Teil, geht sagenhaft geschmeidig von der Bühne. Dieser zweite Teil bringt dann auch endlich mal wieder die Plattentektonik in Wallung mit dem bis hierhin wohl wüstesten Ausbruch der Platte, der stellenweise die Extremität von „Aeolian“ erreicht.
„Parabiosis“ läuft mit seinem durchgehenden Rhythmus und wenig intensiven Spitzen Gefahr, in Beliebigkeit zu verfallen, und stellt damit das schwächste Glied der Trackliste dar. Als Entschädigung erhält der Hörer aber wieder vielschichtige Klangtexturen, die den Song in seinen ruhigeren Passagen regelrecht aufblühen lassen. Beim abschließenden „Subatlantic“ wird es dann wieder richtig stimmungsvoll mit Anklängen orientalischer bzw. vorderasiatischer Volksmusik, die den Fokus jedoch nicht für sich einnehmen. Ebenfalls ein Für: Die Hook nimmt teilweise Züge zeitgenössischer GOJIRA an, die wuchtige Bridge lässt die Erde noch einmal richtig schön beben und zusammen mit den wunderbaren Synth-Elementen ergibt sich hieraus ein passender Rausschmeißer für „Holocene“.
Ist das wirklich das Ende?
Dass das Album im gegenwärtigen Zeitalter angekommen vermehrt atmosphärische, moderne Klänge zur Anwendung bringt, passt wiederum gut in das Konzept von THE OCEAN hinein. Im direkten Vergleich zu den Vorgängern, welche die Messlatte wirklich extrem hoch gehängt haben, ist „Holocene“ insgesamt ein kleines bisschen schwächer. Speziell „Parabiosis“ ist ein kleiner Durchhänger, der allerdings auch nicht im Rohr krepiert und daher auch nicht wirklich zum Dealbreaker wird. Und die Veröffentlichungspolitik um den Song „Unconformities“ hievt ebenfalls Augenbrauen empor. Ansonsten geht der angepasste Sound voll auf und macht „Holocene“ vielleicht nicht zu dem erhofften, überwältigenden Finale (wobei unsereins trotz mehrerlei Andeutung noch skeptisch über das vermeintliche Ende der Albumserie ist, ist aber „nur“ ein reines Bauchgefühl), aber dennoch zu einem ausgesprochen guten Album von gewohnt hochwertiger Qualität, wie nicht anders von Staps und Co. zu erwarten.
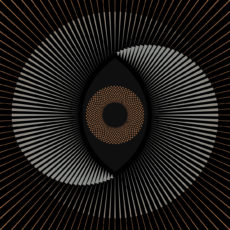



















 Ocean,the - Holocene (Special Edition)
Ocean,the - Holocene (Special Edition) Michael
Michael Ocean,the - Holocene (Standard Edition)
Ocean,the - Holocene (Standard Edition) Ocean,the - Holocene-Ltd 3cd Box Set
Ocean,the - Holocene-Ltd 3cd Box Set































Mal wieder ein großartiges Album. Auch wenn mir aus diesem ganzen Alben-Kosmos die „Phanerozoic I – Palaeozoic“ immer noch am besten gefällt.
Aber die Herangehensweise zeigt, dass die Band einfach jedes Mal Großes leistet und man hört auch deutlich die Unterschiede zu den Vorgängern und trotzdem merkt man, dass es dazu gehört.
Falls es das Ende sein sollte, haben sie sich mit den drei letzten Alben auf jeden Fall ein Denkmal für die Ewigkeit geschaffen.
Für mich ist das eine 10/10.
Pure Magie! Hier sitzt jeder Ton!
Dieses Album ist für mich die erwartet schwere Geburt. Die Vorabsongs ließen schon erwarten, dass sich the Ocean wieder einmal stilistisch verändern werden. Grunsätzlich begrüße ich das auch, dadurch wird es hier nie langweilig, the Ocean haben in all ihren Schaffensphasen überragende Alben geliefert (Precambrian, Pelagial), bzw. waren mindenstens immer gutklassig und eigenständig.
So auch hier, dafür aber ingesamt etwas ruhiger und mit vermehrt elektornischen Elementen angereichert. Teilweise ersetzen diese sogar komplett den klassischen Gitarren-Sound. Grundsätzlich ist das auch kein Problem, allerdings haben sich the Ocean nach meinem Empfinden ein Stück weit ihrer Laut-/Leise-Dynamik beraubt. Klar, das ist sicherlich so gewollt, wie soll man noch etwas steigern was schon zur Perfektion getrieben wurde? Ja es gibt einige Songs die ruhig beginnen und sich zum Ende hin steigern, ist aber nicht mit ältern Alben vergleichbar. Ich erinnere mich an den überragenden Song Jurassice / Cretaceous, das trotz seiner 14 Minuten Laufzeit fast wie ein 3 Minuten Smash-Hit wirkt (ich habe beim Hören auch immer die sie sehr ekstatischen Live-Auftritte vor meinem geistigen Auge).
Das bedeutet mitnichten, dass wir es hier mit einem schlechten Album zu tun haben, ganz im Gegenteil, aber irgendwie ist die Band damit so ein bisschen von ihrer Kernkompetenz abgerückt. Ich gebe trotzdem 9 Punkte weil ich alles andere als unfair empfinden würde auch wenn das hier nie meine Lieblingsscheibe werden wird.
Habe jetzt über ein Jahr gewartet und dem Album immer wieder eine Chance gegeben, aber es klickt einfach nicht. Hat auch nichts mit Purismus zu tun. Neben Metal höre ich auch viel elektronische Musik und liebe z.B. das Cult of Luna / Perturbator Crossover „Final Light“. Ich finde die Lieder einfach nicht gut. Das klingt für mich alles sehr ähnlich und belanglos. Da wo ich mal aufhorche, ist es fast immer der Gesang, der Akzente setzt. Die Instrumentalversion kann ich mir, im krassen Gegensatz zu den Vorgängeralben, gar nicht anhören. Natürlich haben The Ocean die Messlatte in der Vergangenheit extrem hoch gelegt und meine Erwartungshaltung war gewaltig. Ist sicher irgendwo unfair, das Album mit Pelagial und Phanerozoic zu vergleichen, weil es offensichtlich anders sein will. Trotzdem – Das Zeitalter des Menschen ist eine einzige Enttäuschung.